Zurzeit wird ja viel über die mögliche Abschaffung des Frühfranzösischen im Kanton Zürich geredet. Die Kinder in Zürich seien komplett überfordert, wenn sie so früh schon in einer so schwierigen Sprache wie Französisch unterrichtet würden, hört man aus der Politik. Am besten sei es, die Übung Frühfranzösisch abzubrechen, bevor die Gesamtbildung darunter leide. Tant pis.
Diese Idee sei sehr gut nachvollziehbar, schrieb neulich ein wichtiger Redaktor aus Zürich. Französisch gehöre nicht in die Unterstufe. Schliesslich bräuchten junge Menschen in der Schweiz, wenn sie sich über den Röstigraben hinweg verständigen wollten, sowieso nur Englisch. Da sei es nicht nachvollziehbar, weshalb man sie noch mit Französisch belästigten wolle. Voilà.
Dass Moutier auch von Zürich aus gemessen ein bisschen näher liegt als London, will wahrscheinlich niemand wissen. Mit dem Flugzeug ist man aber wohl tatsächlich schneller in London als im Welschland. Qui sait?
Unser Fünfjähriger spricht auch kein Französisch. Er geht erst in den kleinen Kindergarten und so früh fängt das Frühfranzösisch nicht einmal im Kanton Solothurn an. Von den Französischkenntnissen her ist der Kleine also etwas wie ein künftiger Zürcher. Wenn er etwas auf Französisch sagt, dann höchstens Trottoir oder Chauffeur oder, was eher selten vorkommt, Excusez.
Auch was seine Affinität zum Englischen angeht, passt der Kleine sehr gut in die sprachliche Gegenwart. Dabei muss ich zugeben, dass ich seine Englischkenntnisse lange Zeit gar nicht als solche erkannt habe. Das Einzige, was mir auffiel, war sein wiederholter Gebrauch des Worts «Watte». Immer wenn jemand etwas sagte, das dem Fünfjährigen nicht recht passen wollte, sagte er «Watte». Auch wenn ihm beim Spiel etwas nicht gelingen wollte oder ein Würfel zum wiederholten Mal die falsche Zahl zeigte, hörten wir ihn laut und verärgert «Watte» sagen.
Als ich ihn fragte, warum er immer die Watte erwähnt, sagte er, das habe er auf dem Schulweg gehört. Manche Schulbuben sagten das auch, vor allem, wenn sie über etwas erstaunt oder böse seien. Ich fragte den älteren Bruder des Fünfjährigen, ob er wisse, wie die Watte zu ihrer sprachlichen Beliebtheit in unserem Haus gekommen sei. Anfänglich wollte er nicht recht mit der Wahrheit rausrücken. Weil ich aber insistierte, nuschelte er etwas von einem englischen Satz, den man, gemäss den älteren Jungen auf dem Pausenplatz, nicht ganz sagen dürfe, weil er als ganzer Satz irgendwie schmutzig sei.
Erst als ich ihm erlaubte, den schmutzigen Satz zwecks Aufklärung der Sachlage ungeniert zu äussern, gab er das Geheimnis preis. Das Wort «Watte» meines Fünfjährigen war nur der Anfang des englischen Ausrufs: «What the fuck?», der in schriftlicher Form gerne auch als WTF abgekürzt wird und auf Deutsch ungefähr «Was zum Teufel?» bedeutet.
Wenn mir jetzt noch ein Erwachsener erklären will, man dürfe den Kindern nicht zu früh mit Fremdsprachen kommen, werde ich meine Antwort nicht mehr in Watte packen.

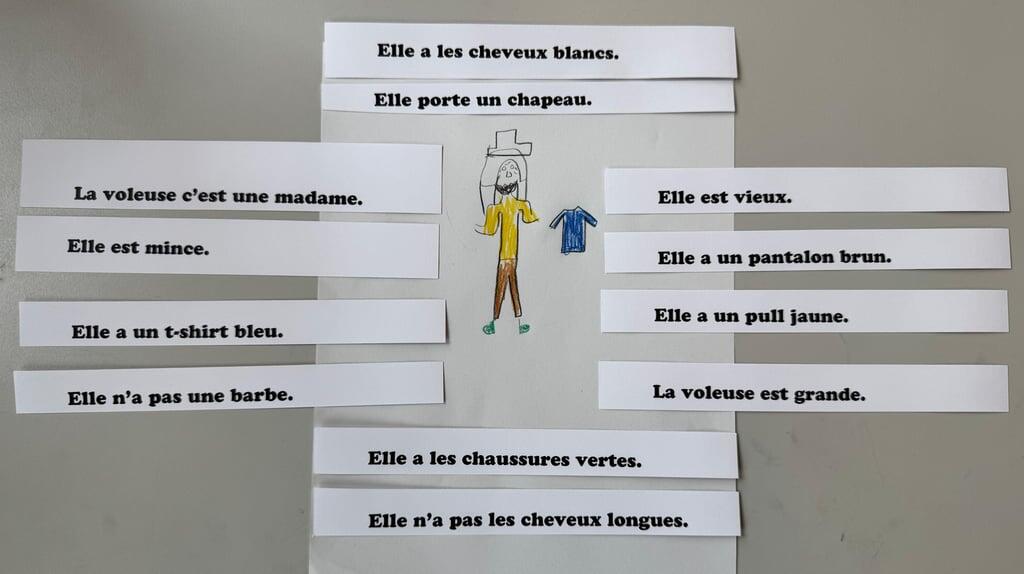






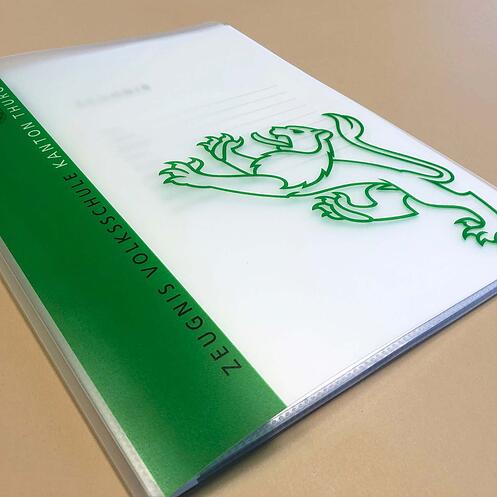
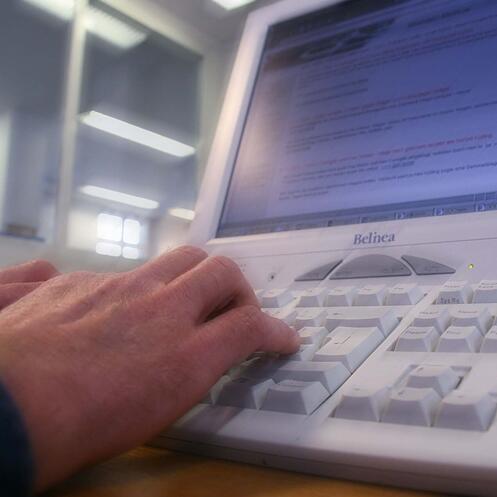

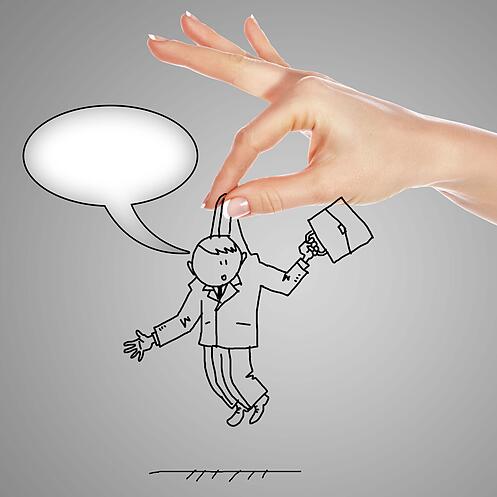








Kommentare
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.