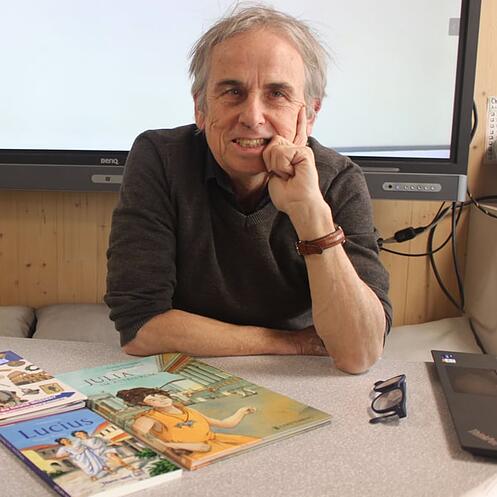Bundesrätin Baume-Schneider droht Zürich mit Französisch-Zwang

Der Entscheid des Zürcher Kantonsrats, den Französischunterricht von der Primar- in die Sekundarschule zu verschieben, hat schweizweit zu reden gegeben. Insbesondere die Romandie habe mit «grosser Irritation» zur Kenntnis genommen, dass Zürich Frühfranzösisch abschaffen wolle, sagt die zuständige Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider im Interview mit der «SonntagsZeitung».
Auf der politischen Ebene sei der Entscheid für die Romandie ein Affront, so die Jurassierin. Denn für die Westschweiz sei schon der Sprachenkompromiss von 2004 ein grosser Schritt gewesen, der es den Kantonen erlaube, Englisch dem Französischen vorzuziehen. «Für uns war das wie der Verlust eines Stücks dessen, was die Schweiz ausmacht. Wenn man jetzt noch weiter geht und Französisch gar nicht mehr will in der Primarschule, ist das ein Bruch des damaligen Versprechens», wird Baume-Schneider im Text zitiert.
Sie werde das Thema noch im September in den Bundesrat bringen und Optionen aufzeigen, sagt Baume-Schneider.Können sich die Kantone nicht einigen oder schaffen sie es nicht, die obligatorische Schule zu harmonisieren, erlasse der Bund entsprechende Vorschriften. Der Bundesrat vertraue darauf, dass die Kantone die Sprachenfrage unter sich regeln könnten, so Baume-Schneider. «Aber wir wissen auch, dass der Bund handeln muss, falls sie das nicht hinbekommen.»
Nestlé-Präsident Paul Bulcke agierte in der CEO-Affäre zögerlich

Paul Bulcke, der Verwaltungsratspräsident von Nestlé, entliess diese Woche seinen CEO Laurent Freixe, weil der Franzose eine Liebesbeziehung zu einer ihm unterstellten Marketingmanagerin verheimlicht und geleugnet hatte. Nun zeigen Recherchen der «NZZ am Sonntag», dass Bulcke bei der Aufarbeitung der Geschehnisse lange Zeit zögerlich vorging.
Aus Gesprächen mit Insidern geht hervor, dass der Präsident früher auf Alarmzeichen hätte reagieren können. Bulcke wusste etwa, dass Freixe schon vor Jahren eine interne Beziehung geführt hatte. Aus ihr entstand seine heutige Ehe. Schon damals kommunizierte Freixe die Beziehung nicht offensiv, wie eine informierte Quelle sagt. Trotz allem verliess sich Bulcke lange auf die Beteuerungen seines CEO.
Bulcke und der Verwaltungsrat müssten sich deshalb den Vorwurf gefallen lassen, interne Hinweise zu wenig ernst genommen zu haben, sagt ein Corporate-Governance-Spezialist einer grossen Zürcher Anwaltskanzlei. Im Mai leitete Nestlé zwar eine Untersuchung durch hauseigene Stellen ein. Doch eine solche interne Abklärung gegen einen CEO sei ein «Himmelfahrtskommando», da es dabei keine Unvoreingenommenheit geben könne.
Freixe sieht sich in der ganzen Affäre offenbar als Opfer. Auf Linkedin schrieb ihm ein ehemaliger Arbeitskollege: «Du kannst stolz auf deine Karriere sein. Das kann dir niemand nehmen.» Darauf antwortete der abgesetzte CEO: «Danke. Einige versuchen es (Sie wissen schon, wen ich meine), aber sie werden keinen Erfolg haben.» Die «NZZ am Sonntag» kontaktierte Freixe, um ihm Gelegenheit zu geben, seine Sicht darzulegen. Doch dieser lehnte ab.
Wie der Clan der reichen Sandoz-Erben erpresst werden sollte

Es tönt wie der Stoff für einen Krimi: Eine Person mit dem Kürzel Mister X. hat versucht, eine der reichsten Familien des Landes zu erpressen. Wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, brüstete sich «Mr X.» damit, über 7000 interne Dokumente aus der Sandoz-Stiftung zu besitzen. Darin soll es unter anderem um angebliche Probleme mit dem französischen Fiskus gehen.
Die Person, die als «Mr X.» auftritt, hätte mit den gestohlenen Unterlagen nicht nur versucht, die Pharma-Erben zu erpressen. Sie hat die Unterlagen laut «NZZ am Sonntag» auch Personen im Umfeld der Familie zum Kauf angeboten. «Die Sandoz-Familienstiftung und das Family-Office sind Opfer eines Erpressungsversuchs», bestätigt die Pressestelle gegenüber der NZZ. Die Täter hätten versucht, die Stiftung mit «völlig aus der Luft gegriffenen, falschen Behauptungen und Fotomontagen zu erpressen».
Die Familie habe sofort Anzeige erstattet. Gleichzeitig räumt die Stiftung ein, dass man nach «ausführlichen Audits» Probleme gefunden habe, «darunter auch steuerliche Unsicherheiten in verschiedenen Ländern». Diese seien von den früher für die Stiftung verantwortlichen Personen verursacht worden. Die Stiftung sei diese Probleme aus der Vergangenheit angegangen und habe die zuständigen Behörden proaktiv informiert.
Mittlerweile seien diese rechtlichen Fragen abschliessend geklärt. Der Krimi rund um die milliardenschwere Stiftung kommt durch den Fall von Ex-Ständerat Fritz Schiesser ans Tageslicht. Der ehemalige Präsident der Stiftung sass diesen Sommer fast zwei Monate lang in Untersuchungshaft. Bei «Mr X.» handelt es sich um eine Bekanntschaft von Schiesser, mit der dieser eine Liebesbeziehung führte. Sie hat die Unterlagen mutmasslich aus Schiessers Büro entwendet.
Jetzt kommts zum Showdown: Keller-Sutter gegen UBS

Am Montag berät der Nationalrat über strengere Kapitalregeln für die Grossbank UBS. Dem Bundesrat unter der Führung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter geht es darum, einen zweiten Fall Credit Suisse zu verhindern. Deshalb drückt die Regierung laut «SonntagsZeitung» aufs Tempo und will so schnell wie möglich etwa die Anpassung der Eigenmittelverordnung umsetzen. Dazu kommen weitere Massnahmen, die schrittweise in Kraft treten sollen.
Eine solche gestaffelte Verabschiedung der Massnahmen wollen aber Parlamentarier vor allem aus FDP und SVP verhindern. Die Motion, die am Montag verhandelt wird, verlangt von Keller-Sutter, alle Massnahmen erst 2027 in einem Gesamtpaket beraten zu lassen. Das gäbe der UBS Zeit. Und damit die Möglichkeit, bis dahin, statt ihr Kapitalpolster aufzubauen, weiterhin Milliarden an die Aktionäre auszuschütten.
Betreibung eingeleitet: Künstler liefert sich wüsten Streit mit Blocher-Schwiegersohn

Der SonntagsBlick berichtet über einen wüsten Streit zwischen dem Schaffhauser Künstler Beat Toniolo und Unternehmer Roberto Martullo, Ehemann von SVP-Nationalrätin und Chefin der Ems-Chemie Magdalena Martullo-Blocher.
Hintergrund ist ein Kunstprojekt von Toniolo. Er entwarf eine 17 mal 24 Meter grosse Fahne, die anlässlich der Fussball-EM der Frauen im Rheinfallbecken ausgebreitet wurde. Roberto Martullo versprach dem Künstler 7500 Franken beizusteuern, dafür druckt Toniolo das Logo seiner Schuhfirma Künzli auf die Fahne. Weil auf die Fahne schliesslich aber auch das EU-Logo aufgedruckt wurde und der EU-Botschafter bei der Eröffnungszeremonie ein Grusswort sprach, zog Martullo sein Sponsoring-Versprechen kurzfristig zurück.
Jetzt liegen die beiden im Streit, Toniolo hat laut SonntagsBlick sogar ein Betreibungsbegehren eingereicht. «Mit seinem kurzfristigen und späten Rückzug verursachte mir Herr Martullo einen organisatorischen und finanziellen Schaden», sagt der Künstler. Milliardärinnengatte Martullo entgegnet: «Ich fühle mich absolut nicht verpflichtet, ihm irgendwelches Geld zu zahlen.»
Armee beauftragt private Pannen- und Unfallhelfer für 6,5 Millionen Franken

Die Fahrzeuge der Schweizer Armee sind derart pannenanfällig, dass das Militär die Unfall- und Pannenhilfe nicht mehr alleine stemmen kann. Deshalb hat das Bundesamt für Rüstung Armasuisse diese Woche Aufträge im Wert von 6,5 Millionen Franken vergeben. Dies ist der Beschaffungsplattform Simap zu entnehmen.
Den Zuschlag erhalten haben drei private Pannenhelfer: das Swiss Dienstleistungszentrum DLC, die Soccorso Stradale Wolfi SA und der Touring Club Suisse (TCS). In Zukunft kümmern sie sich um die gesamte Flotte der Armee, wie Armasuisse auf Anfrage von SonntagsBlick mitteilt.
Heisst: Der TCS schleppt nicht nur kleine Transporter ab, sondern auch Schützenpanzer und Haubitzen. Die Verträge laufen von Januar 2026 bis Ende 2030, mit Option auf zwei Jahre Verlängerung. Schon 2019 beauftragte die Armee private Pannendienste. Bis Ende 2024 (also innert fünf Jahren) rückten sie 3’748 Mal aus. Den Steuerzahler kostete das «ungefähr 3’594’376 Franken», so Armasuisse.