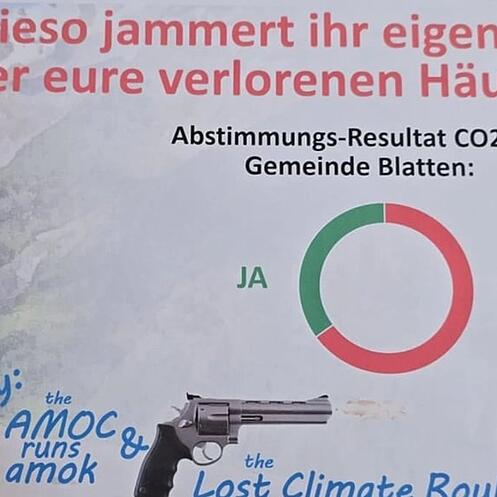Es dauert einen Moment, bis Esther Bellwald eine Träne zulässt. Sie führt ein Dutzend Medienleute durch drei Zimmer ihres neuen Hotels. Erst im letzten davon hält sie inne und sagt, dass auch sie es zum ersten Mal sehe. «Mordsergreifend», sei das.
Sie steht im hellen Zimmer, blickt auf die Berge vor dem Fenster, streicht über die hellen Wolldecken. Sie sind jenen alten Wolldecken nachempfunden, die aus den Trümmern von Blatten geborgen wurden. In 105 Arbeitstagen haben die Blattner das Hotel aus dem Boden gestampft. 64 Betten für das Lötschental. Die letzten Möbel sind an diesem Freitagmorgen erst mit der Seilbahn angekommen. Vieles in den Zimmern ist noch improvisiert. Die Balkonstühle zum Beispiel: Die Wartezeit für neue Terrassenstühle betrug im November 18 Wochen. Stattdessen kauften die Hoteliers die Klappstühle eines schliessenden Restaurants.
Das Hotel «Momentum», ein heller Holzblock auf der Lauchernalp, soll ein Zeichen sein: für die Kraft, die aus einer Krise entstehen kann – und ein Signal an alle Zweifler, dass ein neues Blatten entstehen wird.
Teil 1: Wie konnte das geschehen?
Es ist Mittwoch, der 28. Mai, 15:30 Uhr. Das Kleine Nesthorn stürzt in sich zusammen. 6 Millionen Kubikmeter Gestein krachen auf den unteren Birchgletscher, reisst ihn mit. 10 Millionen Kubikmeter Eis und Fels donnern ins Tal und begraben das Dorf unter einer Staubwolke. In weniger als 60 Sekunden verlieren die Blattner alles.
In diesem Moment sitzt Benjamin Bellwald 1750 Kilometer vom Lötschental entfernt in Oslo. Bellwald ist in Blatten aufgewachsen. Als Kind kann er nirgendwo anders sein: Schon ein Schullager auf dem Simplonpass ist ihm zu weit weg, er hat Heimweh und Albträume.
Bellwald interessiert sich früh für die Berge, die ihn umgeben. Mit sechs Jahren sammelt er Steine ein. Am Gymnasium schreibt er seine Maturaarbeit zur Frage: Ist der Klimawandel menschengemacht? Er studiert Geologie und Glaziologie, Gestein und Gletscher. Genau die Kombination, die in Blatten fatal wird.
Und doch unterschätzt auch er anfangs die Lage, als seine Mutter zehn Tage vor dem Bergsturz aus dem Dorf evakuiert wird. Als sie ihn fragt, was sie für ihn mitnehmen soll, winkt Bellwald ab. Sie solle nach ihren eigenen Wertgegenständen sehen. Ihr Haus ist das letzte in dieser ersten Evakuierungszone, das Haus ihrer Nachbarn wird als sicher eingestuft. Das habe ihn zuversichtlich gestimmt, sagt Bellwald: «Ich dachte, unser Haus trifft wahrscheinlich höchstens ein grösserer Felsbrocken.»
Jetzt sitzt Bellwald in einer dunklen Funktionsjacke am Rand der Terrasse des Panoramarestaurants auf der Lauchernalp und blickt auf den schneebedeckten Schuttkegel, dort, wo einst sein Dorf stand. Erst zwei Tage zuvor ist er wieder in der Schweiz angekommen, seither hat er schon erste Gesteinsproben erhalten und mit dem Gemeindepräsidenten gesprochen.
Für Bellwald, den Wissenschaftler, ist schon kurz nach dem Bergsturz klar: Er will jedes Detail verstehen, was zu dieser Katastrophe beigetragen hat. Bellwald liest alles, was er in die Finger bekommt, tauscht sich mit Experten aus ganz Europa aus. Und kommt zum Schluss: «Das hätte niemand verhindern können.»
Das Gestein am Kleinen Nesthorn ist, im Kontrast zu umliegenden Gipfeln, besonders heterogen. Es besteht aus mehreren Gesteinsarten, die schichtartig übereinander liegen. Das bringe grosse Komplexitäten mit sich. Das Kleine Nesthorn war schon früher instabil, kleinere Steinschläge gab es immer wieder.
Dazu kommt der Untere Birchgletscher: Ein Hängegletscher, der die unteren Gesteinspartien des Kleinen Nesthorns über Jahre von wärmeren Temperaturen abdeckt. Er gilt als einer der gefährlichsten Gletscher der Schweiz und wird seit Jahrzehnten überwacht.
Als Geologe rechnet Bellwald nicht in Jahrzehnten, sondern in Millionen Jahren. Es sei klar gewesen, dass gewisse Bergpartien irgendwann einstürzen werde, sagt er. Warum ausgerechnet in seiner Lebenszeit, auf sein Dorf, das fragt er sich noch heute: «Aber ändern können wir daran nichts.»
Teil 2: Wie sinnvoll ist es, ein Dorf im Gefahrengebiet wieder aufzubauen?
Montagmorgen nach der Eröffnung. Esther Bellwald sitzt an einem Tisch in der Lobby des «Momentum». Es riecht nach neuen Bodenbelägen und frischem Holz, irgendwo surrt ein Bohrschrauber. Ein Elektriker bastelt an einer Steckdose.
Bellwalds Sohn rennt zu ihr, in den Fingern hält er einen zerknitterten Zettel: Eine Liste der Zimmer, daneben Kreuze und Häkchen. Die beiden beugen sich über die Liste, zählen ab, in welchen Zimmern der Fernseher geht, wo die Fernbedienung fehlt. Bei Zimmer 3 steht ein Fragezeichen, «magst du nochmals schauen gehen?», fragt Bellwald. Das Kind rennt wieder los.
Es sei krass gewesen, wie schnell die Klimafrage aufgekommen sei, sagt Bellwald. Das Dorf habe kaum Zeit zum Trauern gefunden. Eine knappe Woche nach dem Bergsturz steht die Frage im Raum: Lohnt es sich überhaupt, das Dorf wieder aufzubauen - oder sollte man die Seitentäler gleich ganz aufgeben?
So falsch sei die Frage nicht, sagt Jelena Kalbermatten. Aber sie sei zu früh und zu rücksichtslos gestellt worden. Die junge Blattnerin mit wilden Locken ist ein «Bärgmeitschi». Ihre Kindheit verbringt sie auf den Skiern, auf dem Bike. Bis zum Bergsturz plant die 23-jährige Radiojournalistin mit dem Jugendverein regelmässig Feste. Einen Monat zuvor hatte sie ein Baugesuch eingereicht, für ein neues Zuhause.
Sie habe erst nach dem Bergsturz gemerkt, wie oft es Naturereignisse in ihrem Dorf gegeben habe, sagt Jelena Kalbermatten. In den vergangenen 150 Jahren kam es fast jährlich zu Lawinen mit grösseren Schäden. Grössere Murgänge traten durchschnittlich alle Jahrzehnte auf – in den letzten Jahren allerdings in immer kürzeren Abständen.
Gleichzeitig habe sie sich nie wirklich unsicher gefühlt, sagt Kalbermatten. Bei Lawinenwarnungen habe sie als Kind einfach hinter dem Haus statt am Hang gespielt. «Und dann war das auch gut so.»
Auch, weil die Schutzmassnahmen immer besser werden. Obwohl es immer noch Lawinen gab, nehmen die Schäden durch diesen Typen Naturkatastrophe ab. Das gilt aber nicht für Extremereignisse wie Jahrhundertfluten oder Bergstürze wie jenen in Blatten.
Sie nerve sich darüber, wie Blatten nun politisch diskutiert werde. Von links spüre sie Überheblichkeit, ein «Wir haben es euch doch gesagt», das trotz allem Mitgefühl durchscheine. Von rechts ärgere sie, dass jede Auswirkung des Klimawandels kategorisch ausgeblendet werde. «Davor können wir doch auch nicht die Augen verschliessen», sagt sie.
Es sei verlockend, den Bergsturz als sichtbare, katastrophische Auswirkung des Klimawandels aufzugreifen. Gerade, weil so viele der tödlichen Klimaveränderungen schleichend kämen, sagt Klimawissenschaftler Benjamin Bellwald. So klar lasse sich das aber, «leider», noch nicht sagen.
Der schmelzende Gletscher habe zwar zum grösseren Schaden beigetragen. Doch die Rolle des Permafrosts - also wie sehr die Temperaturschwankungen durch Erderwärmung das Gestein instabiler machen - sei noch weitgehend unerforscht. Wie genau die Faktoren miteinander interagiert hätten, will er nun mit einer europäischen Expertengruppe prüfen. Das brauche Zeit.
Nur: Zeit haben die Blattner nicht.
Teil 3: Warum alles so schnell gehen muss
Am Montagnachmittag nach der Eröffnung steht Esther Bellwald wieder hinter dem Tresen der Lobby des «Momentum». Vor ihr liegen unfertige Schlüsselkarten und der ausgedruckte Saalplan des Panoramarestaurants, auf dem sie mit Bleistift die Tischverteilung fürs Abendessen notiert.
Ein Gast möchte mit der Karte bezahlen, das Gerät funktioniert noch nicht. Eine ältere Dame fragt nach einem Pflaster. Einen Moment, sagt Bellwald, und kramt eines aus ihrer Handtasche. Ihre beiden Söhne stapfen in Skimontur herein, in den Händen Süssigkeiten, Bellwald schüttelt den Kopf und grinst. Dann seufzt sie. Sie hätte auch einfach nichts tun können, sagt sie: «Dann wäre das alles etwas ruhiger.»
Doch stillsitzen kann sie nicht. Die Arbeit im Hotel sei fast therapeutisch gewesen, sagt Bellwald. Angerissen hat das Projekt ihr Kollege Lukas Kalbermatten, ebenfalls Hotelier in Blatten. Auch er hat alles verloren. Schon in den Tagen nach dem Bergsturz ist für ihn allerdings klar: Der Tourismus müsse jetzt ran. Jemand müsse zeigen, dass es weitergehe, vorangehen, sagt er. Esther Bellwald verreist vier Wochen lang mit ihrer Familie. Dann kommt sie zurück. Und macht sich an die Arbeit.
Vor dem Bergsturz hatte der Tourismus im Lötschental einen Aufschwung erlebt. Die Reiseeinschränkungen während der Corona-Pandemie lockten einheimische Gäste ins Wallis, gerade das Lötschental legte deutlich zu.
Blatten war dafür zentral: Drei der acht Hotels im Tal lagen im Dorf, alle davon zerstört. Dazu ein Campingplatz und das Hotel Fafleralp: Der Bergsturz hat beide von der Aussenwelt abgeschnitten, eine Zufahrtsstrasse soll im Sommer geöffnet werden. Bis dahin fehlen dem Lötschental über 320 Betten.
Dabei ist das Tal stark vom Tourismus abhängig. Viele hätten das erst nach dem Sturz festgestellt, sagt Esther Bellwald. Die Geschäfte, die Bike-Verleihe, die Beizen: «All das geht ohne unsere Gäste nicht im selben Ausmass.»
Auch deshalb ist das «Momentum» so symbolträchtig. Es soll die Einbussen im Tourismus kompensieren, eine wirtschaftliche Zukunft nicht nur versprechen, sondern greifbar machen. Für das ganze Tal.
Viel anderes bleibt den Blattnern nicht übrig. Wenn der Gemeindepräsident Matthias Bellwald seit Tag eins eisern darauf besteht, dass es schon bis 2030 ein neues Blatten geben werde, dann auch, weil es aus finanzieller Sicht schnell gehen muss.
Die Privatversicherer haben zwar 320 Millionen Franken für die Blattnerinnen und Blattner zugesichert. Doch das Geld für die Schäden an den Häusern wird nur vollständig ausbezahlt, wenn sie innert fünf Jahren an einem neuen Ort bauen - in Blatten, oder im ganzen Wallis.
Einige der Dorfbewohner haben schon damit begonnen. Sie bauen in den Nachbardörfern. In der Hoffnung, damit Zeit zu gewinnen. Eine Bewohnerin sagt, sie wolle ihr neues Haus verkaufen, sobald es Gewissheit in Blatten gebe. Und dann dort erneut bauen.
Doch das ist alles andere als gewiss. Für die Bevölkerung ist die Unsicherheit der letzten Monate belastend. Sie frage sich schon, wie es dann aussehe, wenn alle sich ein neues Zuhause gebaut hätten, sagt Jelena Kalbermatten: «Wer soll dann noch zurückziehen?» Soll das Geld in ein neues Blatten fliessen, so müssen schnellstmöglich Bauzonen, Pläne, Projekte her.
Das gilt umso mehr für die jungen Familien im Dorf. Blatten kämpfte bis zum Bergsturz - wie so viele Bergdörfer - gegen die Abwanderung. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde deshalb viel unternommen. Sie hat die Rahmenbedingungen für Neubauten erleichtert oder günstigen Wohnraum geschaffen, indem sie das Pfarrhaus umgebaut hat.
Mit Erfolg: Es zogen vermehrt jüngere Paare und Familien zu. Auch sie stehen vor der Frage, wie es weitergehen soll. Vorübergehend haben sie Unterkünfte in den Nachbardörfern gefunden. Doch wer in die Berge zieht, tut das auch, um sich und seinen Kindern genug Platz geben zu können, solange sie noch aufwachsen. Sie sei in der privilegierten Situation, dass sie keinen Zeitdruck habe. «Aber wir können nicht alle zehn Jahre warten», sagt Jelena Kalbermatten.
Teil 4: Die Solidarität zeigt erste Risse
Zumal die Solidarität mit Blatten schon jetzt auf die Probe gestellt wird. In den ersten Wochen waren die Bekundungen überwältigend: 68 Millionen Franken wurden an die Blattner gespendet.
Schon wenige Wochen nach dem Bergsturz hiess es aus der Gemeinde, es brauche keine weiteren Geldspenden mehr - man wisse kaum, was mit dem Geld anfangen. Seit Herbst gibt es eine Kommission, welche entscheidet, wie die Gelder eingesetzt werden. Im Oktober hat sie 25 Gesuche von Einzelpersonen, Vereinen und Unternehmen bewilligt.
Trotzdem halte sich wohl der Eindruck, die Blattner würden nun reich, sagt Jelena Kalbermatten. Eine Zeit lang habe sie sich deswegen bewusst nicht mehr erwähnt, woher sie komme. Gerade in den Städten scheine das Verständnis für die Bergler oft zu fehlen. Sie nehme dankend an, was sie erhalten habe, sagt Kalbermatten. «Aber ich würde jeden Rappen davon hergeben, wenn ich dafür auch nur einen Tag länger in Blatten bleiben dürfte.»
Auch im Tal dürften sich bald erste Konflikte abzeichnen. Es kamen zwar alle Blattnerinnen und Blattner innert Stunden in Zweitwohnungen in den Nachbardörfern unter. Doch es ist eine Sache, solch eine Wohnung für ein paar Monate freizugeben - und eine andere, das fünf Jahre lang zu tun.
Esther Bellwald geht nicht davon aus, dass sich an der Einstellung der Menschen im Tal zu den Bergen etwas verändern werde. Schliesslich kenne man sich, laufe sich täglich über den Weg. Die Blattner erinnerten das Tal allein durch ihre Anwesenheit daran, was geschehen sei: «Wir sind fast wie wandelnde Mahnmäler.»
Während aber auf der Lauchernalp das Hotel «Momentum» in zwei Monaten aufgebaut wird; das Holz geliefert wird, während die Baugesuche noch nicht bewilligt sind, warten andere seit Jahren auf die Genehmigung ihrer Projekte. Und auch das abgeschnittene Hotel Fafleralp muss bis zum Sommer auf die Zufahrtsstrasse warten. Es heisst nicht umsonst, dass die ältesten Bewohner des Wallis zu zweit seien: der Wind und der Neid.
Teil 5: Was von Blatten bleibt
Vielleicht ist auch deswegen für so viele Blattner klar, dass es etwas Neues geben müsse. Wenige Monate nach dem Bergsturz legen die Behörden eine neue Gefahrenkarte vor.
Obwohl weite Teile des alten Dorfes nicht mehr bebaut werden dürfen, falle die Karte sehr positiv aus, sagt der Klimaforscher Benjamin Bellwald. Noch ist ungeklärt, was mit den Eigentümerverhältnissen geschieht - wem nun welche Parzelle gehören soll. Vielleicht werde man eben dichter bauen müssen, sagt der Wissenschaftler.
Der Optimismus der Blattner sei kein naiver, sagt Bellwald. Von der Terrasse des Panoramarestaurants aus zeigt er auf das Bietschhorn, das über dem Schuttkegel thront. Er zeichnet nach, wo das grau gemischte Gestein in den Überresten des Kleinen Nesthorns langsam schwarz wird: der einheitlichere, stabilere Granit des Bietschhorns. Die grösste Gefahr sei gebannt, die Überreste würden nun minutiös überwacht: «Niemand kann es sich leisten, dass hier noch einmal etwas so Schlimmes geschieht.»
Und doch bleibt für Esther Bellwald vieles offen. Sie sitzt in der Lobby ihres Provisoriums, von dem sie nicht weiss, wie lange es bleiben soll. Für ihre Kinder sei klar, dass sie zurück nach Blatten möchten. Für Bellwald sind viele Fragen ungeklärt, wo sie arbeiten will, wie ihr Leben aussehen soll.
In den Weiler Ried, wo sie aufgewachsen ist und gewohnt hat, kann sie nicht zurück: Der Schutzwald ist dahin, das Gebiet stark lawinengefährdet. Dann komme es eben darauf an, ob man sich an einem neuen Ort heimisch fühlen könne, sagt Bellwald.
Auch Jelena Kalbermatten zögert. Im neuen Blatten werde der Schuttkegel sichtbar sein. Noch habe niemand die Frage laut gestellt, wer sich damit abfinden könne; wer sich das tatsächlich vorstellen könne, wieder in Blatten zu wohnen. «Wenn du nirgendwohin zurückkannst, steht dir die Welt offen», sagte Kalbermatten im Sommer.
Vor wenigen Wochen ist sie nach Davos gezogen, wo sie als Skilehrerin arbeitet. Weg aus dem Tal, weg vom Kegel, weg von der Versuchung, jeden Abend heimkehren zu wollen. In die nächsten Berge. Wahrscheinlich komme sie zurück, sagt Kalbermatten. Bis dahin will sie losziehen, Neues ausprobieren, Neues sehen. «Irgendwann müssen auch wir mit unserem Leben klarkommen», sagt Kalbermatten. «Irgendwann muss es weitergehen.»