Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Text: Hugo Bischof, Grafik: Martin Ludwig
Aschermittwoch
Früher streute man sich an diesem Tag zur Vergebung der Sünden Asche über das Haupt. Wie die Fasnächtler heute nach den närrischen Tagen wieder zu sich finden, ist jedem selber überlassen.
Bruder Fritschi
Unübersehbar. Mit ehrfurchtgebietender gefurchter Holzmaske, langem Bart und im blauweissen Luzerner Staatsmantel. Einige sehen in ihm die mythische Symbolfigur eines heidnischen Fruchtbarkeitskults. Wahrscheinlicher ist, dass sein Vorbild ein «trinkfreudiger» Luzerner Landsknecht namens Fridolin (Friedrich, Fritschi) ist, der in der Schlacht von Ragaz 1446 am 6. März (Fridolinstag) beim Sieg der Eidgenossen über die Österreicher mitkämpfte. An späteren Harnischschauen wurde er als überlebensgrosse Strohpuppe durch Luzerns Strassen gezogen. Heute eröffnet er mit der Fritschifamilie am Schmudo die Fasnacht.
Brüele
Schreien, weinen, brüllen, laut rufen, an der Fasnacht «um etwas betteln», etwa eine Orange.
Chneublätz
Fettgebackenes, fein gepudertes Lozärner Fasnachtschüechli. Ein Renner schon lange vor der Fasnacht – ohne Rücksicht auf Kalorien.
Fötzeliräge
Hunderttausende Papierschnitzel aus zerschnittenen Telefonbüchern regnet es an der Tagwache auf den Kapellplatz hinunter. Telefonbücher gibt’s heute keine mehr; doch Luzerns Fasnachtsorganisatoren haben sich gerüchteweise rechtzeitig einen grossen Vorrat angelegt, der für die nächsten zehn Jahre reichen sollte.
Fritschifamilie
Die Fritschifamilie (Bruder Fritschi, Fritschene, Kindsmagd, Narr, Bajazzo und Bauern) zieht an der Fasnacht von Anlass zu Anlass, beginnend mit der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag. Das Herumziehen im ganzen Ornat ist ein «Knochenjob», versichern Zunftmitglieder, welche die Familie schon verkörpern durften.
Fritschivater
Der für ein Jahr gewählte Vorsteher der Zunft zu Safran, der in dunklem Ornat und mit Zepter an den offiziellen Fasnachtsanlässen seine Aufwartung macht. Nicht zu verwechseln mit Bruder Fritschi.
Grend
Vollmaske, meist aus Pappmaché – ein Muss für jeden echten Fasnächtler.
Güdis
Güdeln bedeutet ursprünglich: Flüssigkeiten zusammenschütteln. Daraus wurde Güdel: Wanst, mit Speisen vollgestopfter Bauch. Am Güdismontag und -dienstag darf man nochmals richtig (fr)essen, bevor am Aschmittwoch die Fastenzeit bis Ostern beginnt.
Guugge
Laute Blechblasinstrumente.
Holdrio
Das Fasnachtsgetränk schlechthin. Man nehme Hagebuttentee, Zucker und natürlich Zwetschgenschnaps. Wobei: Inzwischen hat der Holdrio mächtig Konkurrenz erhalten: Vom «Mönze-Zwätschge» oder schlicht «Tee-Zwätschge». Dabei wird der Hagebutten- kurzerhand durch Pfefferminztee ersetzt. Man sagt, es sei bekömmlicher und «chlöpfe» weniger auf.
Huerenaff
Was wie ein Schimpfwort tönt, ist in Wahrheit eine Ehrenbezeugung. Die ehrenwerten Luzerner Fasnachtsgewaltigen begrüssen sich damit gegenseitig. Das Originalgemälde des Huerenaff hängt im Freihof Geissenhof im Luzerner Sternmatt-Quartier.
Kafi Huerenaff
Wenn's an der Fasnacht kalt wird, stärkt man sich mit dem Kafi Huerenaff, einem starken Kaffee mit Apfel- oder Birnenträsch. Alternativ wird der Kaffee durch Pfefferminztee ersetzt. Dann heisst es Häxetee.
Monstercorso
Der bombastische Abschluss der Lozärner Fasnacht am Dienstagabend mit einem Tatzelwurm von rund 80 Guuggenmusigen, der durch die Innenstadt zieht.
Rüüdig
Meist im Doppelpack verwendet: Rüüdig verreckt. Steht für grossartig, einzigartig, umwerfend gut. Ursprünglich bedeutete es räudig (hautkrank, von Krätzmilben befallen). Vielleicht ein versteckter Hinweis auf das Kratzbürstige, Durchgedrehte der Luzerner Fasnacht – im Gegensatz zu den streng reglementierten drey scheenschte Dääg in Basel.
Schletzfertig
Diesen Ausdruck hört man unter Fasnächtlern öppedie. Gemeint ist die Temperatur des Heissgetränks. Idealerweise erhält man das Tee oder Kafi Zwätschge wohltemperiert, um es möglichst zügig trinken, also «abeschletze» zu können. So ist man gleich bereit für die nächste Runde.
Schmutziger Donnerstag (Schmudo)
«Schmutz» (auch «Schmotz») ist ein alemannischer Dialektausdruck für Fett. Ab dem Schmutzigen Donnerstag ass man sich früher möglichst viele Fettreserven an, um die Fastenzeit (ab Aschermittwoch) gut zu überstehen.
Schränzen
Von Schranz (Riss, Spalt). Ursprünglich der Knall, wenn etwas reisst. Oder das Ploppen, das entsteht, wenn jemand einen Finger aus dem geschlossenen Mund schnellen lässt (ähnlich dem Zapfenziehen beim Wein). Später auf den schmetternden Trompetenton übertragen, der die Luzerner Guuggenmusigen prägt.
Tabu
Ausdrücke, die an der Lozärner Fasnacht tabu sind und die wir den Baslern überlassen: Clique, Morgenschtraich, Waggis, Räppli (Konfetti), Cortège, Larve (Maske), Schnitzelbängg.
Tagwache
Beginn der Luzerner Fasnacht. Es gibt die Safran-Tagwache am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr und die Wey-Tagwache am Güdismontag um 6 Uhr. Beide finden auf dem Kapellplatz statt.
Urknall
Lauter Knall im Seebecken, mit dem am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr der Beginn der Fasnacht angekündigt wird. Abgefeuert wird er von einem Nauen, auf dem die Fritschi-Familie zum Schwanenplatz fährt.
Usgüüglete
Volksfest mit Guuggenmusig, DJ-Party-Sound und Kafi Huerenaff am Dienstag vor dem Schmutzigen Donnerstag unter der Egg in Luzern. Früher kündigte am traditionellen Markttag (Dienstag) ein Ausrufer, begleitet von einem Trommler und einem Trompeter (Güügler), den Leuten vom Land den baldigen Fasnachtsbeginn an.
Zünfte
Im Mittelalter ein Zusammenschluss von Handwerkern und Kaufleuten, die das selbe Gewerbe betrieben. Bekanntestes Beispiel ist die Luzerner Zunft zu Safran, eine um 1400 gegründete Krämergesellschaft. Heute ist es eine Gesellschaft von «traditionsbewussten und zeitaufgeschlossenen Bürgern der Stadt Luzern», die neben der Pflege alten Brauchtums auch kulturelle und dem Gemeinwohl dienende Ziele verfolgt, etwa die Unterstützung von Menschen in Not. Heute hat fast jedes Dorf eine eigene Zunft, meist jüngeren Datums. Auch für sie ist neben der Fasnacht der karitative Gedanke wichtig.




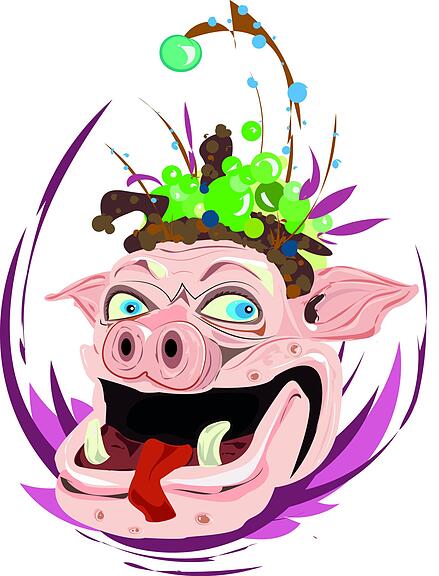




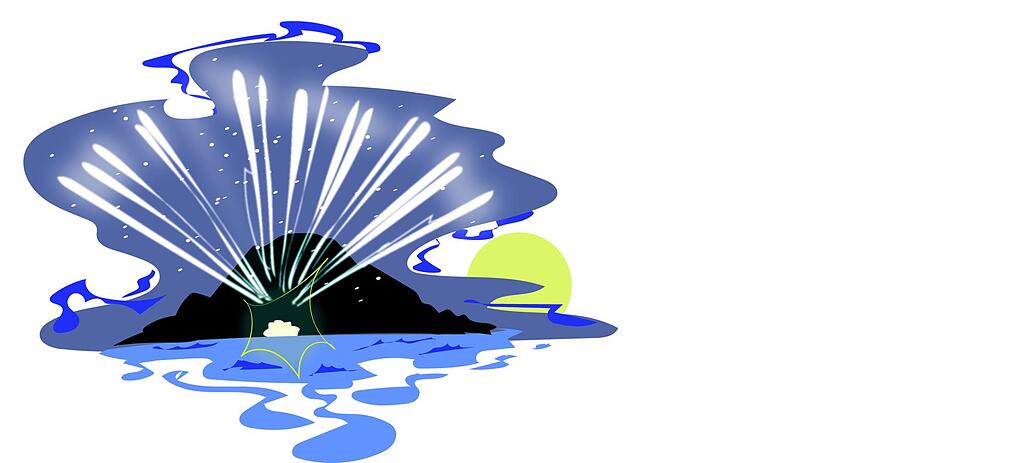
Kommentare
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.