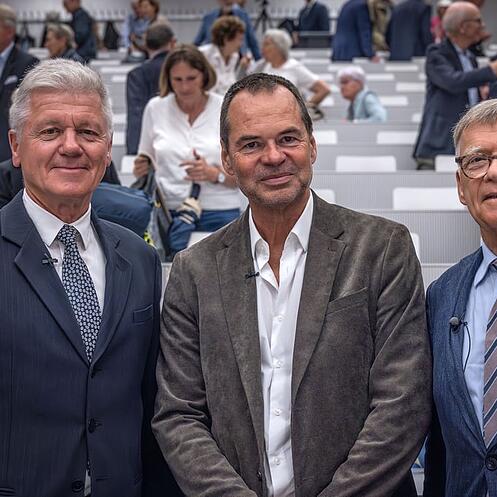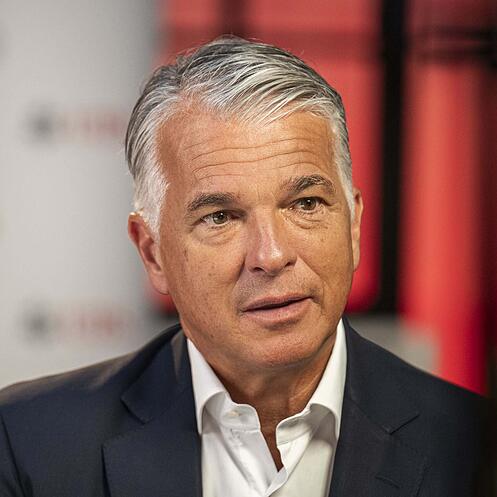Lange hat dieser Satz verfangen – oder besser: Er war so selbstverständlich, dass ihn niemand aussprechen musste. «Die Wirtschaft, das sind wir alle.» Dieser Glaubenssatz wurde nicht gepredigt. Er war keine politische Losung. Es war stilles Einvernehmen. Ein Grundkonsens unter Eidgenossen.
Selbst die Sozialisten widersprachen ihm kaum. Denn auch Marx, ein Klassiker der politischen Ökonomie, wusste: Die Wirtschaft, für ihn das Kapital, ist alles entscheidend.
Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s allen gut. Geht’s ihr schlecht, brechen die gesellschaftlichen Konflikte aus. Im Wort «Wirtschaft» hörte man das «Wir» mit. Wir, das waren Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Konsumenten und Investoren, Kreditnehmer, Kapitalgeber. Wir alle waren gemeint.
Man fand Kompromisse. zwischen Patrons und Chrampfern. Zwischen Kapital und Gewerkschaften. Zwischen Banken und Mietern. Denn man sass im selben Boot. Und man wollte, dass es nicht kentert.
Damals war der Dachverband der Schweizer Wirtschaft fast so einflussreich wie ein Bundesrat. Er trug den sperrigen Namen «Schweizerischer Handels- und Industrieverein». Aber alle nannten ihn einfach: den Vorort. Ein Begriff aus der alten Eidgenossenschaft. Er bezeichnete jenen Ort, der bei einer Tagsatzung jeweils den Vorsitz führte. Der Vorort war nicht bloss ein Gremium – sondern eine Instanz.
Sein Wort wog schwer. Und die Patrons und Industriellen, die er vertrat, hatten Gewicht. Diese lebten diskret. Gaben sich nicht pompös, sondern bodenständig. Reichtum zeigt man nicht. Die Patrons und Industriellen hatten – bei allem Eigeninteresse – das grosse Ganze im Blick.
Der Vorort wurde 1870 gegründet. Später vereinte man das Elitäre mit dem Lauten: den stillen, einflussreichen Vorort und die kampagnenfreudige Wirtschaftsförderung. Daraus wurde im Jahre 2000 Economiesuisse. Der neue Verband war professioneller, aber auch wirtschaftsferner. Seither werden Positionspapiere produziert, Workshops veranstaltet, Appelle lanciert, Interviews gegeben. Das ist alles gut und recht. Doch etwas Entscheidendes ist verloren gegangen: Der gesellschaftliche Grundkonsens hat sich aufgelöst.
Die Wirtschaftsfreundlichkeit der Schweiz ist geschwunden. Was nachrückte, ist Unbehagen, Abneigung – ja, bei manchen offene Feindseligkeit gegenüber allem Unternehmerischen. Unternehmer: Das waren früher hoch angesehene Leute. Weil alle wussten: Sie schaffen mit ihren Erfindungen und Innovationen Arbeitsplätze.
Die Wahrnehmung ist heute eine andere. Ich nenne zwei Symptome. Erstens: Die sogenannte Konzernverantwortungs-Initiative. Ein Frontalangriff auf das Prinzip unternehmerischer Selbstverantwortung. Nur das Ständemehr konnte sie noch verhindern. Zweitens: Die Abstimmung zur 13. AHV-Rente. Ohne Finanzierungskonzept angenommen – gegen jede ökonomische Vernunft. Einfach so, weil’s einen Zustupf gab.
Diese beiden Urnengänge haben die Wirtschaftsvertreter aufgeschreckt. Etwas ist ins Rutschen gekommen. Denn früher fanden Wirtschaftsvorlagen immer eine solide Mehrheit im Volk. Was also ist geschehen?
Drei fatale Vertrauensbrüche
Um das zu verstehen, müssen wir nochmals an den Anfang dieses Jahrhunderts, zur Jahrtausendwende zurück. Ein Jahr, nachdem der Vorort verschwand, groundete die Swissair. Sie war nicht irgendeine Airline. Sie war Symbol. Für Seriosität. Für Qualität. Für Swissness. Und sie ging unter – nicht am Markt, sondern an Hybris.
Besoldete Manager wollten aus ihr ein globales Imperium machen. Sie spekulierten, wurden grössenwahnsinnig, kauften marode Airlines auf – mit dem Geld anderer Leute. Und sie scheiterten. Es war das erste Mal, dass ein neuer Satz die Runde machte: «Gewinne privatisieren – Kosten sozialisieren.»
Mit dem Untergang der Swissair war ein Bruch im Vertrauen geschehen. Nicht bloss in einzelne Manager – sondern in «die Wirtschaft», auch und vor allem in den Freisinn als Wirtschaftspartei.
Der zweite Bruch folgte 2008. Die UBS – gerettet mit 66 Milliarden Franken. Wieder hatte sich das Management auf verantwortungslose Weise verzockt. Wieder zahlte die Allgemeinheit. Und wieder hiess es: «Gewinne privatisieren, Kosten sozialisieren.» Das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger war verletzt. Zu Recht.
Seither geistert der Begriff «Abzocker» durch die Debatten. Und auch wenn er pauschal ist – das Phänomen, das er bezeichnet, ist real. Es beschreibt jemanden, der mit fremdem Geld spielt – und daran verdient. Wenn es gut geht: Jackpot. Wenn nicht: zahlt ein anderer.
Der dritte Bruch erfolgte mit dem Niedergang der CS. Eindrücklich und akkurat beschrieben von Journalist Arthur Rutishauser in seinem Buch «Der Fall der CS». Geldgierige und unfähige Manager, überforderte Verwaltungsräte, eine zu brave Finma und ein passiver Finanzminister haben das Ende der CS zu verantworten.

Über Jahre hinweg wurde die einst so stolze Kreditanstalt mit krimineller Energie – man kann es nicht anders sagen – geplündert. Die Bank als Selbstbedienungsladen. Die grösste Sünde dabei: Die Manager haben sich mit dem Plazet des Verwaltungsrats und der Finma in den vergangenen zehn Jahren, als die Bank noch existierte, 32,5 Mia. Franken an Boni ausbezahlt und sich damit schamlos bereichert, obwohl die Bank in diesem Zeitraum 3,5 Mia. Fr. Verluste schrieb.
Am Ende war das Eigenkapital viel zu schwach, die Liquidität geschrumpft, die Reputation schwer angeschlagen. Das Vertrauen dahin, ein Bank-Run die Folge.
Verheerende Boni-Kultur
Abzockertum hat nichts mit Unternehmertum zu tun. Es ist das Gegenteil von Verantwortung. Und es ist der Nährboden für die heutige Wirtschaftsfeindlichkeit. Die Boni-Kultur hat sich seither zur Boni-Obsession gesteigert. Niemand versteht, dass auch dann noch Boni ausbezahlt werden, wenn es einer Unternehmung schlecht geht, wenn sie Verluste schreibt. Sind die Manager nicht verantwortlich für den schlechten Geschäftsgang?
Boni sind Teil des Grundlohns geworden. Eine verfehlte Entwicklung. Sie sollten eine Auszeichnung, eine Honorierung für guten Geschäftsgang sein. Nicht mehr und nicht weniger. Man kann sie auch ganz abschaffen. Denn die fragwürdige Praxis verletzt – einmal mehr – das Gerechtigkeitsempfinden. Es sind nicht die anständigen Manager, die anständigen Unternehmer, die die Schlagzeilen prägen. Sondern die Gierigen, die Geldsüchtigen, die Gescheiterten.
Ein Wort zu den Medien. (Die kann ich als Medien-Unternehmer nicht gut aussen vor lassen.) Die Medien berichten, zugegeben sei’s, mit Lust am Skandal. Journalisten wollen aufdecken. Das Negative interessiert mehr als das Positive. Macht leider mehr Klicks. Man gewinnt so den Eindruck, dass es mehr Skandale gibt als Erfreuliches. Doch Erfindungen und Innovationen würden wahrscheinlich die Leute mindestens so sehr interessieren. Warum nicht mehr darüber berichten?
Und die Politik? Sie reagiert. Aber sie führt nicht. Und die Vertreter der Realwirtschaft? Die Unternehmer? Sie schweigen. Es ist – zugegeben – das Schweigen der Anständigen. Aber warum nur schweigen sie?
Schweigen aus Angst vor dem Shitstorm?
Ich wage hier eine Hypothese. Es könnte sein, dass manche aus ihrer Zunft Angst haben. Angst vor dem Shitstorm. Lieber sich nicht exponieren. Gibt nur Scherereien. Seit Google (1998), Facebook (2004) und Twitter (2006) ist klar: Alles Gesagte kann aufgezeichnet werden. Was aufgezeichnet ist, kann veröffentlicht werden. Und was veröffentlicht ist, kann skandalisiert werden. Und jeder kann Sender sein.
Ein falscher Satz – ein falscher Ton – genügt. Und die Welle rollt. Was dann folgt, ist ausser Kontrolle. Fake News, Beleidigungen und Anschwärzungen grassieren und werden nicht korrigiert. Eine verantwortliche Kuratierung fehlt. Viele Unternehmer haben das verstanden. Und sich zurückgezogen. Aus Angst vor dem Shitstorm. Sie reden nicht mehr. Oder nur noch im PR-Deutsch. Abgesichert, vorformuliert, ohne Ecken und Kanten. Das Resultat: Der öffentliche Diskurs über die Wirtschaft wird von anderen geführt.
Leider ist das Bild in der Öffentlichkeit längst verzerrt. Die Wirtschaft erscheint als Gegner der Gesellschaft. Das ist grundfalsch. Nur: Dieses Narrativ wird von vielen geglaubt – weil zu wenig dagegengehalten wird. Was also ist zu tun?
Erstens: Die Boni-Kultur muss enden. Boni dürfen nur bei Gewinn ausgeschüttet werden. Das versteht jeder Lehrling. Und falls nötig, braucht es dazu ein Gesetz. Zweitens: Die Anständigen müssen ihre Angst, ihre Vorsicht überwinden. Wirtschaftliches Handeln ist kein Makel. Es ist Grundlage unseres Wohlstands.
Vor allem aber: Unternehmer, Patrons, Eigentümer – sie sind die glaubwürdigsten Fürsprecher. Sie haben Skin in the Game. Sie stehen ein – mit Namen, Kapital, Verantwortung. Sie sollten sich auch öffentlich wieder mehr äussern, Stellung beziehen zu wirtschaftlichen Fragen, sich zum Unternehmertum bekennen. Mit klarer Sprache. Mit eigener Meinung. Mit Mut zur Kontroverse.
Denn sonst sprechen andere. Und sie tun es längst. Der Wokeismus ist ein Beispiel. Er konnte nur Raum greifen, weil andere geschwiegen haben. Er predigt Toleranz – aber lebt Ausgrenzung. Wer nicht mitmacht, wird gecancelt. Auch hier: Die Stimme der Anständigen fehlt.
Natürlich ist der Shitstorm unangenehm. Aber er ist nicht das Ende der Welt. Im Gegenteil – man überlebt ihn. Und aufgrund der gemachten Erfahrung wird man stärker, gelassener. Darum braucht es heute eine neue Kommunikationsstrategie. Eine ehrliche, mutige Sprache, die die Dinge beim Namen nennt. Und neue Gesichter, die für unternehmerisches Denken und Handeln einstehen.
Die Verantwortung beginnt oben. Bei den Unternehmern. Bei den Eigentümern. Bei den Chefs. Bei denen, die führen. Sie müssen nicht alles anders machen. Aber: Sie müssen wieder sichtbar werden. Sie müssen wieder reden. Denn nur so wächst neues Vertrauen. Fazit: Die Zeit der schweigenden Patrons ist vorbei.
Wir brauchen heute eine neue Generation von Unternehmern, die nicht nur still arbeiten – sondern auch erklären. Und kommunizieren. Nicht nur denken – sondern auch reden. In der Öffentlichkeit. Denn: Wer schweigt, wird regiert. Wer spricht, gestaltet die Debatte. Und gewinnt am Ende dank Glaubwürdigkeit.
Dieser Text ist die Rede, die Peter Wanner, Verleger von CH Media (u.a. «Schweiz am Wochenende») an der Preisverleihung des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) hielt. Dieses zeichnet herausragende wirtschaftsjournalistische Leistungen aus. Preisträger 2025 ist Arthur Rutishauser, der den Untergang der Credit Suisse recherchierte.