Ein Schriftsteller im Boxclub? Als Benjamin von Wyl auf die Interviewanfrage um 21 Uhr telefonisch antwortet, sagt er entschuldigend: «Sorry, ich komme direkt vom Boxtraining und bin noch voller Dopamin.» Und nach kurzer Überraschung denkt man: Passt doch, denn seine Literatur hat schliesslich auch einen hohen Puls und verwandelt unsere chaotisch zerrissene Gegenwart in energiegeladene, dringliche, fiebrige, hoch reflektierte Geschichten.
In der spektakulären Zeitsatire «Land ganz nah» (2017) rutscht die politische Schweiz mit ihren Gegensätzen in einen Bürgerkrieg; in «Hyäne – Eine Erlösungsfantasie» (2020) laufen die Figuren in der Leistungsgesellschaft wie mit 42 Grad Fieber dem Wahnsinn entgegen, und im Roman «In einer einzigen Welt» (2022) übernimmt gar ein weltumspannender Pilz das Kommando über unser Bewusstsein (künstliche Intelligenz und Internet lassen grüssen).
Wenn man seine Bücher nach Grossthemen sortieren möchte, dann legt von Wyl nach Politik, Gesellschaft und Internet nun mit «Grosswerden und Einknicken» ein Buch vor, das man als melancholischen Klimaroman lesen kann – allerdings zum Glück gespickt mit fabelhafter Fantastik.
Wenn der Erdkern einstürzen würde
Wasser spielt eine entscheidende Rolle. In «Grosswerden und Einknicken» lässt er einen verunsicherten Jungen von seinem Erwachsenwerden erzählen. Dieses Aufwachsen ist geprägt von naivem Glauben, Begeisterung für kuriose Naturphänomene und der Angst vor dem Zusammenbruch der Erde. Wie bei Jules Verne glaubt dieser Jona, der Erdkern sei von Höhlen durchzogen, zudem sei er wie ein Skelett, auf dem Diamanten wachsen – deren Abbau in der Tiefsee bringe dieses Skelett jedoch zum Einstürzen. Raubbau an der Natur, apokalyptisches Szenario: Das Motiv der Klimaangst ist greifbar.
Stilistisch gekonnt schlüpft Benjamin von Wyl in die Kinderperspektive. «Jona kommt nie richtig im Erwachsensein an», sagt von Wyl, «er bleibt egozentrisch, bleibt Beobachter. Er schafft es im Gegensatz zu seinem Freund Petrit nicht, ein pragmatisches Leben zu führen, das den Zwiespalt von Wunsch und Realität aushält.» Jona neige zu sehr zum Absoluten und scheitere daran.
Den Aufklärer hat er als Tattoo auf dem Arm
Nun sitzen wir am Basler Rheinufer und von Wyl sprudelt vor Erzähl- und Erklärlust, schwärmt ungeniert vom Boxen, von Basel als schönstem Ort der Welt und ist gleich darauf ein superkritischer Intellektueller.
In seinem Journalistenjob bei Swissinfo, dem internationalen Kanal der SRG, beschäftigt er sich mit den Wahlen in Südafrika, Menschenrechtskongressen und sozialen Bewegungen – und dazwischen also Boxen: «Nach dem Training mit dieser Verausgabung habe ich das absolute Glücksgefühl», schwärmt der 33-Jährige. Und fügt gleich hinzu: «Schreiben Sie unbedingt den Namen des Clubs, sonst ist man dort beleidigt», denn der KSSB-Boxclub sei ein sehr familiärer Club mit grundhumanen Werten.
Boxsport kommt in seinen Romanen nicht vor. Er habe leider erst vor zwei Jahren angefangen, sagt er. Aber dass er den Kampf und den unbedingten Siegeswillen feiern würde, etwa wie Bertolt Brecht als Provokation gegen die scheinheilige Zivilisiertheit des Bürgertums, ist nicht zu erwarten. Das würde sein literarisches Selbstverständnis widerlegen. Seine Literatur ist zwar randvoll mit scharf-bitterer Gegenwartskritik, ist aber weder politischer Aktivismus noch heroische Pose. «Romane zu schreiben, ist fast nie eine Form des politischen Handelns. Denn politisches Handeln würde Eindeutigkeit bedingen», sagt er. Und ergänzt: «Es ist wichtiger, den Müll rauszubringen. Es ist wichtiger, sich für eine andere Gesellschaft zu engagieren, für Menschen da zu sein, die uns nahestehen.»
Den Aufklärer trägt er auch so immer mit sich – am rechten Unterarm sieht man die Tätowierung «Henrik Ibsen Ein Volksfeind», eine Anspielung auf den hartnäckigen, scheiternden Idealisten im Theaterstück, der gegen Korruption kämpft.
«Literatur ist besser als der Heilige Geist»
Romanschreiben also bloss ein rauschhafter, melancholischer Leerlauf? Das würde verwundern bei einem, der kaum 20-jährig für die SP in den Nationalrat wollte, der sich seit Jahren in vielen Kolumnen über Patriarchat und Sexismus nervt, über Klimakrise und Gesellschaftsveränderung nachdenkt. Einer, der seit dem Studium als Journalist arbeitet und alle zwei Jahre einen Roman publiziert, für die er auch noch Literaturpreise erhält. Ein Getriebener? Ja, sicher, intellektuell hochtourig, aber im Umgang sympathisch entspannt, keine Spur von Verbissenheit.
Das hat wohl auch mit seiner Reflektiertheit zu tun. Vom freikirchlichen Milieu geprägt und sich davon gelöst, sagt er, Journalismus sei besser als Jesus und Literatur besser als der Heilige Geist. So lautete auch der Titel seiner Poetikvorlesung an der Uni St.Gallen. Will heissen: Journalismus biete keine Rettung, sondern liefere Überprüfbares für das Verständnis der Gegenwart und stärke so «die Navigation» im eigenen Leben. Und Literatur bediene sich bei Symbolen, beim Übersinnlichen, Fantastischen, der Suggestion, dem Zeichenhaften, aber biete keine Erlösung, kein himmlisches Happy End – höchstens in Kitschromanen.
Benjamin von Wyls Romanfiguren sind ja auch nicht eindeutig, sondern zum Glück immer ambivalent. Literatur liefere eben Medizinbeutel, einen Sammelbehälter mit allerhand Nützlichem, aber keinen Jagdspeer, der Beute macht oder Schuldige trifft – ein Bild, das er der Autorin Ursula K. Le Guin entlehnt hat.
Ein bisschen Brecht steckt auch in ihm
Und wie kommt er auf die fantastischen Elemente wie den Weltpilz oder das Erdskelett? «Auch darauf gibt es keine eindeutige Antwort», sagt er. Es ist die Summe von Gehörtem, Erlebtem, von Musik, sicher inspiriert von dystopischen Romanen und wohl auch vom «Codex Seraphinianus» aus dem Jahr 1978, eines seiner Lieblingsbücher, eine Enzyklopädie einer erfundenen Welt.
«Man malt das eigene Spiegelbild immer neu, formt es neu», sagt Benjamin von Wyl. Autofiktion ist das nicht. «Absprung» nennt er die Erfahrungen, aus denen seine Romane entstehen. Im neuen Roman verwandelt er diese in eine teils verrückte, fabulierende Fantastik: «Wenn ich im Verschobenen, im Märchenhaften stochere, entdecke ich auch ganz neue Elemente: Ich bin überzeugt, dass man in der Fiktionalisierung der Gesellschaft dem Grotesken mehr abringt als im Versuch einer Bestandesaufnahme.»
Zur Kenntlichkeit verfremden sagt man gemeinhin dazu. Und wenn er mit Autoreinschüben die Lesenden aus dem Lesefluss und dem glatten Interpretieren wirft, mag man das als Augenzwinkern verstehen: Hey, denkt selbst mal! Ein bisschen Brecht steckt also doch in Benjamin von Wyl.
Benjamin von Wyl: Grosswerden und Einknicken. Roman. Verlag die Brotsuppe, 211 S.
Derselbe: Warum Journalismus besser ist als Jesus (und Literatur als der Heilige Geist). Poetikvorlesung. Edition Frida, 118 S.


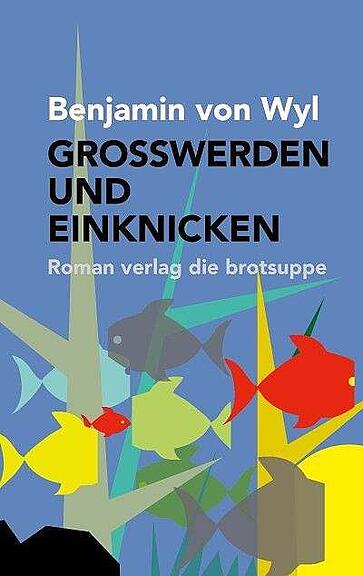
Kommentare
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.