Bei Katzen und Elefanten besteht eigentlich keine Verwechslungsgefahr. Doch so sehr sich die flinken Fellnasen von den grauen Rüsseltieren unterscheiden, so verblüffend ähnlich sind sich die Erkenntnisse in den kürzlich erschienenen Büchern zweier Autorinnen. Bei ihren Meditationen über verwilderte Katzen und domestizierte Elefanten stolpern sie immer wieder über Urteile zu Frauen und weiblichen Körpern. Prägnant formuliert es die Luzernerin Gianna Rovere in ihrem Debüt «Episoden von Alltagselefanten»: Das lyrische ich fühlt sich dort manchmal «wie die Elefantin, die in den patriarchalen Zoo gesperrt, begafft, beglotzt, bewertet, kommentiert und bespuckt wird».
Frigide Katzenfrauen und kätzische Flittchen
Nicht als Elefantin, sondern als «Cat Lady» stigmatisiert wird die US-Amerikanerin Courtney Gustafson. Mit dem Einzug in eine neue Wohnung treten rund 30 abgemagerte und kranke Streuner in ihr Leben, die sich unkontrolliert in den Hecken der Auffahrten und zwischen Mülltonnen vermehren. So wird sie nicht nur zur «selbstständigen Katzenretterin», sondern auch zur Catfluencerin auf Tiktok. In ihrem Memoir mit dem in der deutschen Übersetzung unterkomplexen Titel «Katzen und Kapitalismus» begibt sich Gustafson mit den Streunern auf einen Streifzug durch ihr Leben und hinterfragt die Logiken des amerikanischen Traums sowie der kapitalistischen Leistungsgesellschaft.
Dabei stets mit im Raum: ihr Frau-Sein. Nicht zuletzt, weil sie mit ihrem Engagement für die Streuner fälschlicherweise als einsame, frigide Frau typisiert wird, «als wäre die Sorge um die Streunerkatzen unvereinbar mit einer romantischen Beziehung». Als «Cat Lady» hatte Donald Trump im Wahlkampf abwertend Taylor Swift bezeichnet – was dazu führte, dass viele in den sozialen Medien den Begriff positiv als Selbstbezeichnung verwendeten.
Wenn dann hingegen, wie es Courtney Gustafson in ihrem Buch beschreibt, die Kätzinnen als «Flittchen» geslutshamed werden, weil sie ihrer tierischen Natur entsprechend auf Partnersuche sind, schreibt sie lakonisch oder resigniert: «zu viel Sex, nicht genug Sex». Wie sehr sich diese ständigen Be- und Verurteilungen von weiblichem Aussehen und Verhalten auch in ihrem eigenen Denken und Handeln verankert haben, wird Gustafson erst bewusst, als es für sie unwichtig wird, sie mit Katzenfutterflecken bekleckert, verrissener Hose und wilder Mähne ihre Freundinnen wissen lässt, sie habe sich gehen lassen. Was nach Rechtfertigung klingt, liest sich vielmehr als Befreiungsschlag. Das erste Mal seit ihrer Kindheit habe sie etwas gemacht, «ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie ich aussah».
Wasserflecken und Elefantenhaut
Wo die Katzen Gustafson Abstand zu gesellschaftlichen Schönheitsstandards nehmen lassen, ist der Körper bei Rovere Dreh- und Angelpunkt. In ihrem schönen Band mit fragmentarischen Beobachtungen und Überlegungen über die Dickhäuter begibt sie sich auf Safari. Im Gegensatz zum linearen Fliesstext bei Gustafson assoziiert Rovere lose über die Elefanten, die ihr über den Weg laufen.
Mal ist es der Elefantenfuss in seiner Mehrdeutigkeit, mal der rüsselartige Schlauch eines Hörgeräts, mal der Wasserfleck auf der Zürcher Langstrasse, der nur mit viel Fantasie als Elefant erkennbar ist, mal das Tattoo auf einem Oberschenkel. Entstanden ist ein buntes Bündel aus freien Assoziationen, Alltagsobjekten und Anekdoten, die einen schmunzeln, interessiert stutzen oder leer schlucken lassen. Etwa wenn die Kindheitsfreundin beim Dicksein der grauen Riesen an «nichts Ekliges» denke, aber nicht mehr mit dem lyrischen Ich hatte befreundet sein wollen, als deren Körper sich in der Pubertät zu verändern begann. Oder wenn die ansonsten positiv als robust konnotierte Elefantenhaut in Form von Cellulite an Frauenbeinen nicht kommentiert gehört; «das ist unhöflich». Rovere bleibt Einordnungen und Erklärungen oft schuldig. Indem sie die Elefanten damit sichtbar im Raum stehen lässt, animiert sie subtil zum Nachdenken.
Die Auseinandersetzung, sei es mit Elefanten oder Katzen, bietet eine Aussensicht auf ein Ökosystem gesellschaftlicher Praktiken und Umgangsformen; ein Blick von aussen in das gesellschaftliche Gehege gewissermassen. Dieser Blick über die Tiere auf das eigene Verhalten ist eine der Stärken dieser originellen Resonanzräume. Gustafson bringt die zentrale Frage auf den Punkt: «Da sind kleine, weiche Kätzchen, die unter meinen Fingern schnurren. Und ich soll die Falte zwischen meinen Augen nachfahren und glauben, ich hätte versagt?»
Gianna Rovere. Episoden von Alltagselefanten, Verlag sechsundzwanzig.
Courtney Gustafson. Katzen und Kapitalismus, park x Ullstein. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Katharina Martl.


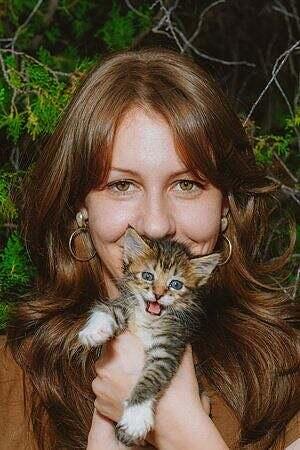

Kommentare
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.