
Seine damalige Verlegerin Ulla Berkéwicz ging er bei einem Empfang einmal körperlich an und rempelte ihr ungestüm gegen den Gipsarm, den er für Fake hielt. «Der Gips war echt. Der Verlag war nicht mehr meiner», erzählte Thomas Melle vor ein paar Jahren in einem Interview mit dem «Spiegel». Und bei einem seiner zahlreichen Psychiatrie-Aufenthalte sagte er einer anderen Patientin, die Osama Bin Laden für ihren Vater hielt, auf den Kopf zu, das sei Blödsinn. «Dabei vermutete ich zu dem Zeitpunkt selbst, der Sohn des Popstars Sting zu sein.»
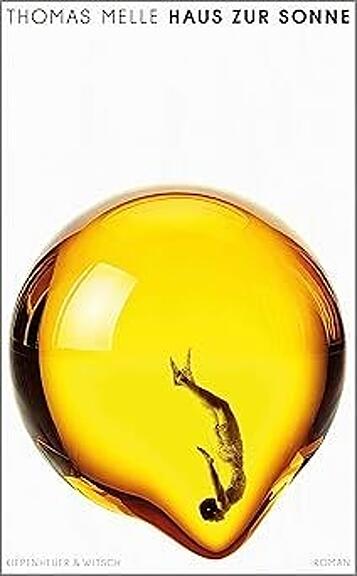
Thomas Melle kann ganz schön unberechenbar sein. Grund dafür ist seine bipolare Störung, über die er schon in seinem Buch «Die Welt im Rücken» qualvoll authentisch geschrieben hat. Der Titel schaffte es 2016 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Damals war an Corona noch nicht zu denken. Heute, nach den Erfahrungen der Lockdowns, nimmt das Thema «Depressionen» einen ganz anderen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung ein. Das dürfte dem 1975 in Bonn geborenen Schriftsteller herzlich egal sein. Trotzdem wird sein neuer Roman «Haus zur Sonne» noch mehr Aufmerksamkeit erregen, setzt Melle sich darin doch erneut mit seiner manisch-depressiven Erkrankung auseinander.
Mit einem makabren Todeswunsch in die Psychiatrie
Weil die Hoffnung sich nicht erfüllt hat, mit dem Buch über die bipolare Störung nachhaltig etwas geordnet und abgeschlossen zu haben, und die Manie zurückkehrt, nachdem er einen kontroversen Artikel über den «Nobelpreis an Peter Handke und das Medium Twitter» geschrieben hat, begibt sich der Ich-Erzähler, der mehr als nur ein paar Züge des realen Autors trägt, in eine Einrichtung, die sich «Haus zur Sonne» nennt. Völlig am Ende mit sich und der Welt schliesst er dort einen mephistophelischen Pakt. Der Deal: In dem staatlich geförderten Sanatorium soll ihm jeder Traum erfüllt werden, wenn er danach seinem Todeswunsch nachkommt und aus dem Leben scheidet. Was ihm zunächst entgegenzukommen scheint, wird, je näher der Tag X rückt, zu einer immer grösseren Prüfung.
Unmittelbar und schamlos schildert Thomas Melle in seinem autofiktionalen Roman den Leidensdruck. Er schafft es, der Krankheit eine Sprache abzuringen. Das ist literarisch nicht schlecht gemacht, in seiner Redundanz und dem niederschmetternden Nihilismus aber nur schwer zu ertragen. Weite Strecken lesen sich wie eine quälende Litanei. Im Kontrast dazu stehen die Wünsche, die dem Protagonisten durch Simulationen erfüllt werden, indem er Medikamente erhält oder über einen Stecker im Nacken an virtuelle Welten angeschlossen wird. Alles wäre möglich. Aber die Krankheit bringt es mit sich, dass der Patient einfallslos ist und zu nichts Lust hat. Und so lesen sich die Traumpartien dann auch.
Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischen
Während «Die Welt im Rücken» noch mit wahnwitzigen Ideen überraschte, Thomas Melle im Berliner Techno-Club «Berghain» Picasso traf oder Sex mit Madonna hatte, fällt der «Katalog der Wünsche» im neuen Buch doch ziemlich einfallslos aus. Mal malt er sich aus, an einer Gruppensex-Orgie teilzunehmen, mal eine biedere Hausfrau zu sein oder als Forscher durch die Entwicklung eines Medikamentes den Krebs zu besiegen. Vieles bleibt abstrakt. In einem Szenario, das an Hermann Hesses «Steppenwolf» erinnert, öffnet er verschiedene Türen, hinter denen sich aus einem diffusen Sfumato verschiedene Szenen abzeichnen.
Literatur kann die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischen, ganz ähnlich wie das im Kopf eines psychisch Kranken geschieht. Das ist die Idee hinter diesem ebenso waghalsigen wie wahnwitzigen Roman. Die Lektüre ist keine Freude. So wie das Leben keine Freude ist. Thomas Melle, der aufs Bonner Jesuitenkolleg geschickt wurde, weiss das als Sohn eines alkoholkranken Stiefvaters. In den Jahren zwischen seinen manischen und depressiven Phasen trotzt er seinem Leben immer wieder ein Buch ab. Schon Journalist Magnus in «Sickster» (2011) war psychotisch, und der obdachlose Exjurastudent Anton in «3000 Euro» (2014) stürzte während einer Manie ab. Literatur ist für Thomas Melle Therapie. «Das Schreiben hat mich in irre Räume zurückgeführt, die mir bekannt waren, die ich aber mit einem Schutzanzug betreten habe: dem Erzählmodus.»
Thomas Melle: Haus zur Sonne. Roman. Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten.

Kommentare
Bitte beachten Sie unsere Richtlinien, die Kommentare werden von uns moderiert.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben.