Die «SonntagsZeitung» hat exklusiv Daten aller Kantone ausgewertet und kann damit zeigen, wo jene Multimillionäre wohnen, die von der Juso-Erbschaftssteuer-Initiative betroffen wären. Spitzenreiter ist der Kanton Nidwalden: Auf 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen dort 22 Personen mit einem Vermögen von über 50 Millionen Franken. In der Nidwaldner Gemeinde Hergiswil ist es gar jeder Hundertste. Selbst die beiden anderen bekannten Innerschweizer Tiefsteuer-Kantone, Zug und Schwyz, können überraschenderweise nicht mit Nidwalden mithalten.
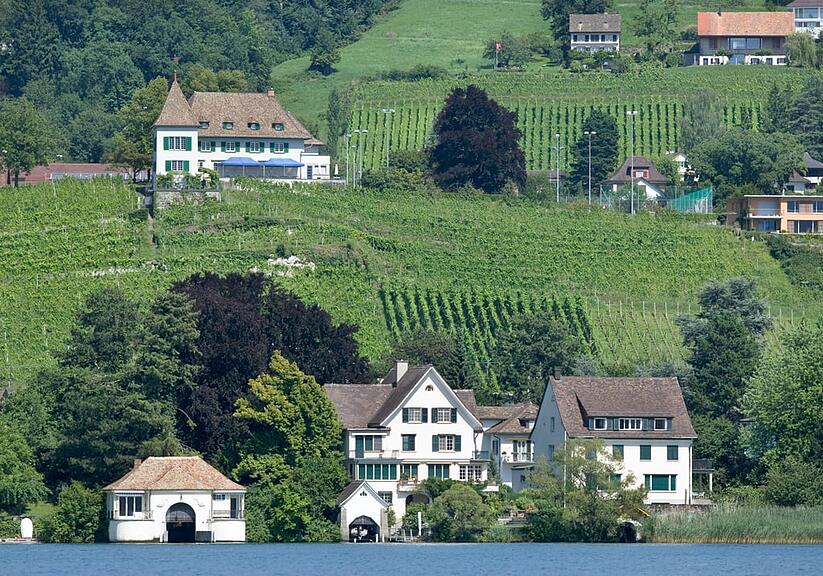
Dort leben zwar ebenfalls viele Superreiche, doch die Multimillionärs-Dichte ist mit je 18 pro 10’000 Einwohner bereits deutlich tiefer. Wie krass die Unterschiede innerhalb der Schweiz sind, zeigt der Vergleich mit den strukturschwachen Regionen: In den Kantonen Aargau, Freiburg, Jura und Neuenburg lebt weniger als ein Superreicher auf 10’000 Einwohner. In absoluten Zahlen betrachtet, gibt es in den wirtschaftsstarken Stadtkantonen die meisten Menschen mit Vermögen von 50 Millionen Franken oder mehr: In Zürich etwa sind es 400 und in Genf 370.
Amtliche Schätzungen zeigen, dass die Zahl der Superreichen in der Schweiz in den letzten 20 Jahren deutlich angestiegen ist – und damit auch die Abhängigkeit von ihnen. So hätte die Annahme der Juso-Initiative laut Reto Föllmi, Professor für Volkswirtschaft an der Uni St. Gallen, insbesondere für Zürich gravierende Folgen. Der Kanton etwa würde laut Föllmis Berechnungen jährlich rund 340 Millionen Franken verlieren – fast zehn Prozent seiner Einkommenssteuern.
Hinter den Kulissen: Bund und Kantone planen Verschärfung der Asylgesetze
Straffällige Asylsuchende sollen in Zukunft konsequenter inhaftiert und ausgeschafft werden. Interne Protokolle des Asylausschusses von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden zeigen, wie die Behörden aufs Tempo drücken. Ziel ist laut «SonntagsBlick» ein Gesetzespaket, das bestehende Zwangsmassnahmen verschärft. In einem Protokoll des Asylausschusses hält die Arbeitsgruppe Sicherheit fest, dass «diese Arbeiten mit hoher Priorität vorangetrieben werden müssen». Unter anderem aufgrund von Forderungen aus dem Parlament.
Gemäss dem Dokument haben verschiedene Akteure aus dem Asyl- und Ausländerbereich Vorschläge eingereicht. Diese sollen jetzt in ein «kohärentes Gesetzgebungspaket» überführt werden, über das schliesslich das Parlament abstimmen kann. Konkret soll zum Beispiel die Schwelle für Ausschaffungshaft gesenkt, die Höchstdauer für maximale Administrativhaft ausgedehnt und die Verhängung der Anwesenheitspflicht in zugewiesenen Unterkünften erleichtert werden. Das Staatssekretariat für Migration bestätigt die SonntagsBlick-Informationen und erklärt, dass die Anpassungen voraussichtlich das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie das Asylgesetz betreffen werden.
Flims, Laax und Falera kaufen ihr Skigebiet
Im bekannten Bündner Wintersportort Laax ging es am Freitagabend hoch her. Die Gemeindeversammlung stimmte über die grösste Investition ab, die eine Schweizer Öffentlichkeit je in ein Skigebiet getätigt hat: Es geht um den Kauf der sogenannten Weissen Arena durch die Standortgemeinden Flims, Laax und Falera. Damit soll verhindert werden, dass ausländische Investoren die für die Region wichtigen Bergbahnen übernehmen. Das kostet aber viel Geld – 50 der insgesamt 100 Millionen Franken müssten die Gemeinden selber bezahlen – und ist entsprechend umstritten. Dabei spielen nicht nur die hohen Summen eine Rolle, sondern auch starke Emotionen, wie beim Besuch der «SonntagsZeitung» an der Versammlung klar wurde. Am Ende wurde aber der Deal mit 359 zu 14 Stimmen angenommen. Falera sagte bereits am Donnerstag deutlich Ja. Und in Flims wird am Sonntag an der Urne darüber abgestimmt.

Schweizer Nato-Botschafter warnt vor gefährlicher Sicherheitslage
Laut Jacques Pitteloud, dem Schweizer Botschafter bei der Nato, ist die Lage in Europa so gefährlich wie noch nie in den letzten Jahrzehnten. «Alles deutet darauf hin, dass wir uns im Zustand eines relativen Krieges befinden», sagt Pitteloud im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Die massgeblichen Akteure USA und Russland liessen ihre wahren Absichten weitgehend im Dunkeln und sendeten widersprüchliche Botschaften aus. In der Sicherheitspolitik sei aber nichts so gefährlich wie Ungewissheit: «Wenn die Absichten des einen Akteurs nicht eindeutig sind, kann der andere Akteur die falschen Schlüsse ziehen», sagt der Botschafter.
Bei der Nato herrsche zudem eine paradoxe Situation. So sei die Allianz noch nie so stark wie heute gewesen: «Mit Schweden und vor allem Finnland sind zwei der stärksten Armeen dem Bündnis beigetreten, und die Mitgliedsstaaten haben ihre Rüstungsausgaben stark erhöht.» Gleichzeitig sei die Nato noch nie so geschwächt gewesen wie heute. Denn die Absichten der Amerikaner seien unklar – und die USA seien entscheidend für die Nato. In der Schweiz sei derweil das Bewusstsein für den Ernst der Situation erstaunlich wenig ausgeprägt. «Immer wenn ich in Zürich lande, habe ich das Gefühl, dass dieses Land in einer anderen Welt lebt», sagt Pitteloud
Richard David Precht: «Wir haben uns übersensibilisiert»
Umfragen zeigen: Eine wachsende Anzahl Menschen hat das Gefühl, sie könnten ihre Meinung nicht mehr frei äussern. Der bekannte deutsche Philosoph Richard David Precht hat das Thema in seinem neuen Buch gründlich durchdrungen. Sein Befund: Viele – vor allem auch Jüngere, die im Internet sozialisiert wurden – hätten tatsächlich Angst, an den Pranger gestellt zu werden, wenn sie etwas sagten, das nicht dem Mainstream entspreche.

Schuld daran seien nicht nur die sozialen Medien, sondern genauso die Leitmedien, die von «der Erregungswelle profitieren wollen», sagt Precht im Interview mit der «SonntagsZeitung». «Wenn alle immer sensibler und emotionaler werden, dann schwindet der öffentliche Raum, in dem miteinander geredet oder gestritten werden kann. Das kann eine liberale Demokratie dauerhaft nicht aushalten. Wir haben uns im Umgang miteinander übersensibilisiert», so Precht weiter, «wenn dem nicht so wäre, dann gäbe es diese Erregungskultur im Netz nicht.»
ChatGPT führt zu höherer Arbeitslosigkeit in der Schweiz
Knapp drei Jahre ist es her, dass der Chatbot ChatGPT lanciert wurde. In der Öffentlichkeit wird seither eine Debatte geführt, welche Folgen KI für die Arbeitswelt hat. Vor allem Vertreter der Tech-Branche prognostizieren das grossflächige Verschwinden von Jobs in Wissensberufen. Andere halten die Technologie für masslos überschätzt und attestieren ihr höchstens einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Nun liefert eine neue Studie des KOF-Instituts der ETH erstmals belastbare Zahlen für die Schweiz.

Die Ergebnisse bestätigen die Warner: «Seit Ende 2022 sehen wir einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Berufen, die der KI stark ausgesetzt sind im Vergleich zu Berufen, die kaum betroffen sind», sagt Michael Siegenthaler, Leiter Arbeitsmarktanalyse beim KOF in der «NZZ am Sonntag». Bei jüngeren Arbeitnehmern ist die Arbeitslosigkeit stärker gestiegen als bei älteren. Besonders betroffen durch KI sind Programmierer, Webentwickler oder Datenbankadminstratoren. Aber auch in Jobs ausserhalb der Informatik hinterlässt KI Spuren. In der Buchhaltung, im Rechnungswesen und im Bereich Sekretariat kann KI die Prozesse stark beschleunigen und menschliches Personal ersetzen. (has)

