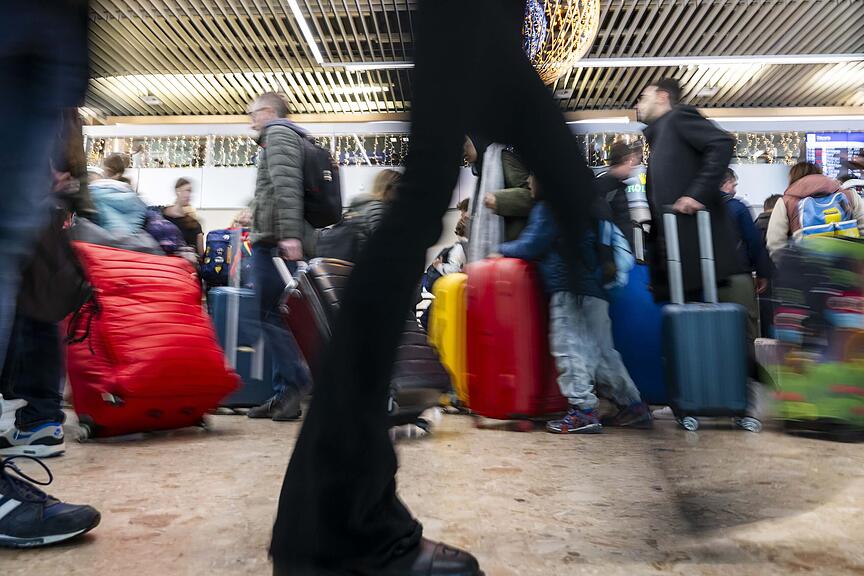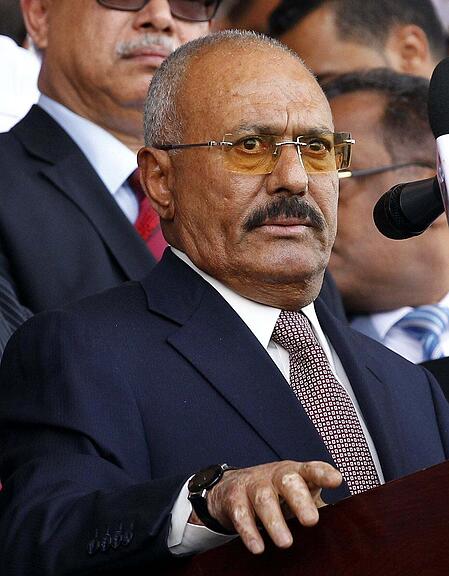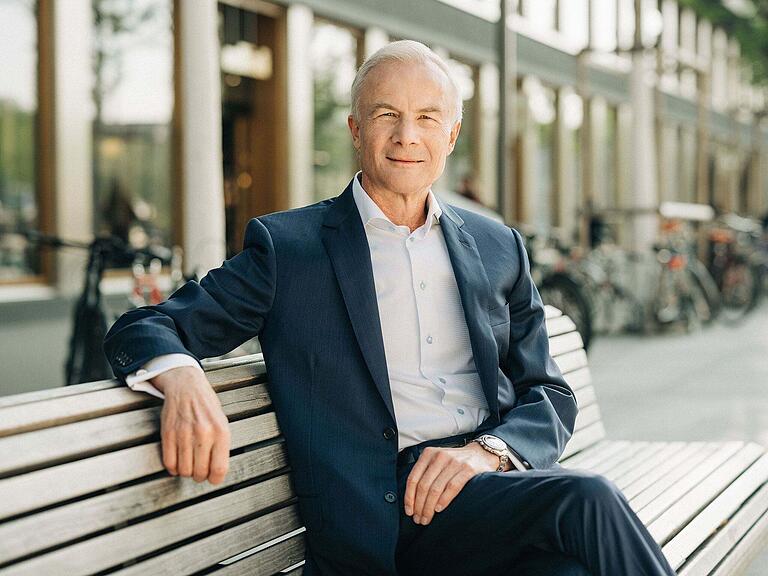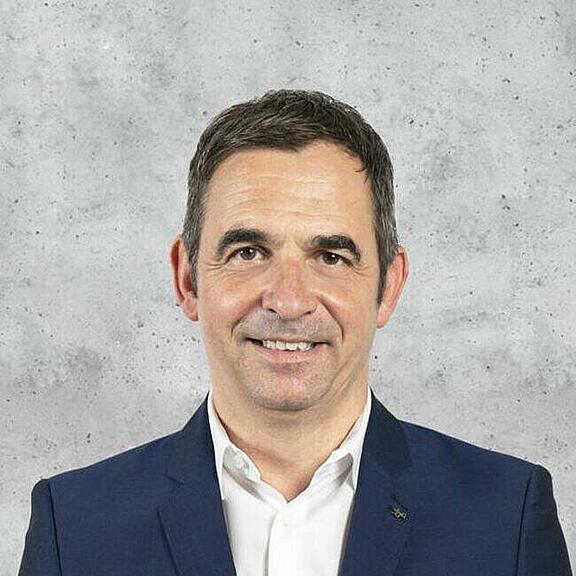13:23 Uhr
Freitag, 28. Juni
Neuer Beschaffungs-Chef für Migros
Der Migros-Genossenschafts-Bund baut eine gemeinsame Gruppenbeschaffung auf. Die Leitung dieser Direktion übernimmt laut einer Mitteilung vom Freitag Florian Decker. Der 42-Jährige ist derzeit bei der deutschen Kette Edeka als Geschäftsführer für die Eigenmarken tätig.
Migros, Denner, Migrolino und Migros-Online legen demnach Teile ihrer Beschaffung zusammen. Die neue Einheit zentralisiere Aktivitäten von gruppenübergreifenden Lieferanten und verstärke die Zusammenarbeit mit der internationalen Einkaufsorganisation Everest Fresh. Damit könne die Migros-Gruppe ihr Einkaufsvolumen bündeln und die Konditionen verbessern. Mittel- bis langfristig soll der Warenaufwand «deutlich reduziert» werden, was in Form von tieferen Preisen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden soll. (ehs)
09:27 Uhr
Freitag, 28. Juni
Dank Auslandsgeschäft: Das Schweizer BIP wächst auch im Juni leicht
In der Schweiz sind im Juni leicht mehr Waren und Dienstleistungen produziert worden. Wie die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) am Freitag mitteilt, ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Juni im Vergleich zum Vormonat um einen halben Prozentpunkt auf den Stand von 102.7 Punkten gestiegen. Seit Jahresbeginn liegt das BIP damit auch «weiterhin in einem leicht überdurchschnittlichen Bereich», so die KOF.
Verantwortlich für den jüngsten, leichten Anstieg sind laut den Konjunkturforschenden vor allem «günstigere Aussichten für das Auslandsgeschäft». Auch das Gastgewerbe könne verstärkt profitieren. Dagegen trüben sich die Perspektiven im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie bei den übrigen Dienstleistungen leicht ein, so die Prognose. (sat)
07:28 Uhr
Freitag, 28. Juni
Nach Fusion: Starrag Tornos mit Gewinnwarnung und weniger Umsatz
Vor gut einem Jahr haben sich die bisher unabhängigen Firmen Starrag und Tornos zur Starrag Tornos Gruppe zusammengeschlossen. Ziel der beiden Werkzeugmaschinen-Hersteller war es, gemeinsam am Markt schlagkräftiger auftreten und Synergien nutzen zu können.
Doch nun muss die neue Starrag Tornos Gruppe mit Hauptsitz in Rorschacherberg (SG) zuerst einen Schritt zurück machen. Wie sie am Freitag mitteilt, führt die herausfordernde Situation am Weltmarkt zu einem tieferen Nettoumsatz als es die kumulierten Umsätze der beiden ehemaligen Firmen erwarten liessen. Diese Entwicklung gelte für das erste Halbjahr wie auch für das Gesamtjahr 2024. Der Auftragseingang liegt laut Starrag Tornos jedoch auf kumuliertem Vorjahresniveau.
Wenig überraschend wird laut Starrag Tornos infolgedessen auch der operative Gewinn (Ebit) «deutlich niedriger» ausfallen. Dies führt das Unternehmen «vor allem auf die konjunkturelle Entwicklung in wichtigen Absatzmärkten» zurück. Die bereits früher kommunizierten mittel- und langfristigen Ziele der Starrag Tornos Group werden durch die aktuelle Situation laut Mitteilung nicht tangiert. (sat)
07:06 Uhr
Freitag, 28. Juni
Implenia erhält Zuschlag zum Bau des neuen Axenstrassen-Tunnel
Wegen Murgängen muss die Axenstrasse immer wieder gesperrt werden. Das ist Autofahrern und Behörden seit langem ein Dorn im Auge. Darum haben der Bund und die Kantone Uri und Schwyz längst entschieden, die Verbindung zwischen Flüelen und Sisikon entlang des Vierwaldstättersees sicherer zu machen.
Herzstück der neuen Axenstrasse ist der Bau zweier neuer Tunnels: Dem Morschacher Tunnel (2,9 Kilometer) und dem Sisikoner Tunnel (4,4 Kilometer). Für letzteren steht seit Freitag die Bauherrin fest. Wie Implenia mitteilt, hat eine Arbeitsgemeinschaft unter deren Führung - in Zusammenarbeit mit der Bauunternehmung Frutiger - den Zuschlag für das 430 Millionen Franken teure Projekt erhalten.
Wie Implenia ausführt, rechnet der Baukonzern aus dem Zuschlag für sich mit einem Auftragsvolumen von über 250 Millionen. Erfolgt gegen die Vergabe nicht noch eine Einsprache, nennt Implenia als Baubeginn «Mitte 2025». Der Sisikoner Tunnel soll dann bis 2034 fertig gestellt werden.
Nebst den beiden Tunnel soll zum Schutz vor Murgängen im Gebiet Gumpisch zudem eine Galerie erstellt werden. Damit soll die neue Axenstrasse besser geschützt werden, namentlich der Eingang zum neuen Sisikoner Tunnel. (sat)
17:32 Uhr
Donnerstag, 27. Juni
Steht «Cargo sous terrain» vor dem Aus?
Die Dimension: gigantisch. Die derzeitigen Erfolgsaussichten: gering. Die Rede ist vom Megaprojekt Cargo sous terrain (CST), das 2016 lanciert wurde mit dem Ziel, den Schweizer Güterverkehr zu revolutionieren. Kern des Projekts wäre ein Tunnel vom Genfer- bis zum Bodensee für den Transport von Waren – betrieben mit erneuerbaren Energien. Mit an Bord als Hauptaktionäre waren zu Beginn namhafte Firmen wie Coop, Helvetia, Migros, Mobiliar, Swisscom, Vaudoise, ZKB und die Post. Sie schiessen 100 Millionen Franken ein. Der Schwerverkehr auf den Nationalstrassen soll künftig um 40 Prozent reduziert werden und die Feinverteilung in den Städten effizienter gestaltet werden. Für die Gesamtkosten wurden 30 Milliarden Franken prognostiziert.
Doch laut verschiedenen Berichten herrscht derzeit Krisenstimmung. Das Portal «Inside Paradeplatz» schreibt, dass die «halbe Mannschaft» entlassen wurde, was 20 Mitarbeitenden entsprechen würde. Gegenüber dem «Blick» dementiert eine CST-Sprecherin dies: «Die Zahl bewegt sich im einstelligen Bereich.» Sie bestätigt dafür Informationen der Zeitung, dass die Geschäftsleitung aufgelöst wurde. Dies habe mit einer «Anpassung der Leitungsstruktur der Firma» zu tun. CST soll dadurch «effizienter und wettbewerbsfähiger» gemacht werden.
CST-Geschäftsführer Peter Sutterlüti, ein ehemaliger Post-Spitzenmanager, ist demnach zurückgetreten und ist nur noch im Verwaltungsrat. Dies vermeldete das Unternehmen selbst am Mittwoch auf seiner Website. «Der Rückzug von Peter Sutterlüti aus dem operativen Geschäft war schon länger geplant und wäre früher vorgesehen gewesen», sagt die Sprecherin gegenüber «Blick». «Verdankenswerterweise hat er sich bereiterklärt, als CEO zu fungieren, bis das Projekt den Reifegrad der Sachplananhörung erreicht hatte.»
Im Frühjahr wurde allerdings bekannt, dass verschiedene Städte und Kantone dem Projekt wenig Chancen geben. Zu teuer, zu wenig praktikabel – so der Konsens. Die Stadt Zürich kritisierte die geplanten Standorte scharf: Diese «genügten fachlichen Anforderungen nicht»; zudem reduziere CST den motorisierten Verkehr in der Stadt nur gerade um 0,3 Prozent. Wenig hilfreich dürfte auch der Absprung der SBB im Herbst 2022 gewesen sein. Die damalige Begründung der Bundesbahnen: Man wolle sich auf den Kernauftrag konzentrieren.
Spätestens 2031 sollte der erste Abschnitt eröffnet werden – vom Cargo-Drehkreuz Härkingen in die Stadt Zürich. Dieser Fahrplan ist laut CST inzwischen Makulatur. Wie die Aktionäre reagieren, ist unklar. Die CST-Sprecherin sagt: «Wir sind im Kontakt mit dem Aktionariat. Es ist im Sinne aller Beteiligten, wenn sich die Planung von CST auf die heutigen Gegebenheiten einstellt und die eingebrachten Mittel möglichst effizient eingesetzt werden.» (bwe)
16:45 Uhr
Donnerstag, 27. Juni
Neuer Fatca-Deal: Schweiz wird Altlast in den USA los
Es ist noch nicht lange her, da war das Bankgeheimnis heilig – und der automatische Austausch von Bankdaten zwischen Ländern die grösste Gefahr am politischen Horizont, die es mit allen Mitteln abzuwehren galt. Mit aller Kraft stemmte sich der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz noch im März 2008 dagegen und liess aus dem Nationalratssaal die Welt wissen: «Jenen, die das schweizerische Bankgeheimnis angreifen, kann ich voraussagen: An diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch noch die Zähne ausbeissen.»
Nur ein Jahr später, im März 2009, gab die Schweiz klein bei und akzeptierte den zuvor heftig umstrittenen OECD-Artikel 26 und verzichtete fortan auf die etwas spitzfindige Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Von dort bis zur Einführung des automatischen Informationsaustausches (AIA) war es nur noch ein kleiner und vor allem absehbarer Schritt. Dennoch wollten das viele Politiker und Behördenmitglieder nicht wahrhaben. Deshalb wurde auch im Verhältnis zu den USA ein Sonderweg eingeschlagen.
Neu bekommt auch die Schweiz Daten
Statt das amerikanische Standard-Steuerregelwerk Fatca von 2010 zu akzeptieren, das letztlich analog zum AIA funktioniert, handelten die hiesigen Diplomaten unter der Leitung des damaligen Staatssekretärs Michael Ambühl eine kompliziertere Alternative aus: Das sogenannte Modell 2, bei dem die Schweiz nichts bekam und auf umständlichen Wegen trotzdem viele Daten liefern musste, galt ab 2014. Im Oktober 2014 beschloss der Bundesrat dann, den automatischen Informationsaustausch einzuführen, in Kraft ist er seit 2017.
Die Tinte auf dem Fatca-Abkommen war also kaum trocken, schon bereuten viele den Sonderdeal. Immer wieder versuchte das Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen (SIF) in der Folge, den Behörden und den Banken mit einem Modellwechsel das Leben einfacher zu machen. Doch lange blieb das Dossier in den USA blockiert.
Nun ist das SIF unter der Führung von Staatssekretärin Daniela Stoffel die Altlast los geworden. Am Donnerstag haben die USA und die Schweiz ein neues Fatca-Abkommen unterzeichnet. Das heisst: In Zukunft müssen die hiesigen Banken nicht mehr mit den Amerikanern direkt arbeiten, sondern können die geforderten Daten amerikanischer Kunden an die Eidgenössische Steuerverwaltung schicken, die sie wiederum den zuständigen US-Behörden weiterleitet. Und im Gegenzug erhält neu auch die Schweiz automatisch Kontodaten aus den USA.
Der Modellwechsel soll voraussichtlich ab 2027 gelten.Zuvor benötigt die Umsetzung des Fatca-Abkommens eine Anpassung des nationalen Rechts. Hierzulande wird sich also das Parlament nochmals mit dem automatischen Datenaustausch befassen müssen.
Die Zähne daran ausbeissen, will sich aber wohl niemand mehr. (fv)
08:08 Uhr
Donnerstag, 27. Juni
Ex-Reka-Chef Roger Seifritz in Quickline-VR gewählt
Der ehemalige, langjährige Direktor der Schweizer Reisekasse (Reka), Roger Seifritz, ist in den Verwaltungsrat (VR) des Telekommunikations-Unternehmens Quickline gewählt worden. Er folgt in dem Amt auf Beat Brechbühl, der nach zwölf Jahren als unabhängiger VR von Quickline zurückgetreten ist.
Neben Seifritz sind an der Generalversammlung auch Roger Kälin und Philipp O. Müller für Günther Seewer und Mathias Prüssing in den VR gewählt worden. Wie Quickline am Donnerstag mitteilte, gehören Kälin und Müller dem achtköpfigen Verwaltungsrat als Vertreter von Verbundpartnern an, Seifritz und Präsident Felix Kunz als unabhängige Mitglieder.
Seit September 2022 bietet Quickline seine Produkte nicht nur im eigenen Kabelnetz und in Netzen der Partner an, sondern in der ganzen Schweiz. Dafür greift das Unternehmen aus Nidau auf die Infrastruktur der Swisscom zurück – etwa deren Glasfaser- und Kupfer-Netz sowie das Mobilfunknetz.
Vergangenen Herbst verliess aufgrund von Differenzen bei der Expansionsstrategie der frühere CEO Frédéric Goetschmann das Unternehmen. Seit Januar führt darum VR-Präsident Felix Kunz die Firma ad interim. Ein neuer CEO wurde bislang nicht vorgestellt. (sat)
13:23 Uhr
Mittwoch, 26. Juni 2024
Mehr Geld für den öffentlichen Regionalverkehr
Der Bund will den regionalen Personenverkehr (RPV) in den Jahren 2026, 2027 und 2028 mit knapp 3,5 Milliarden Franken unterstützen. Das entspricht laut einer Mitteilung des Bundesrats vom Mittwoch einem Anstieg der Abgeltungen um durchschnittlich 1,7 Prozent pro Jahr. Ein grosser Teil der zusätzlichen Mittel wird für Investitionen, z.B. in neues Rollmaterial oder Instandhaltungsanlagen, sowie für die Finanzierung von Angebotsausbauten verwendet. Konkret nennt der Bund ein neues Angebot im Kanton Jura, die Inbetriebnahme des Hochrhein-Bodensee-Express sowie verschiedene Taktverdichtungen etwa zwischen Liestal und Basel und zwischen Luzern und Engelberg.
Der Bund übernimmt durchschnittlich die Hälfte der ungedeckten Kosten des RPV. Die andere Hälfte tragen die Kantone. Der Anteil des Bundes schwankt jedoch stark: In strukturschwachen Regionen übernimmt er einen Grossteil des Defizits – in Graubünden etwa 80 Prozent – in strukturstarken Kantonen nur einen kleinen Anteil. Im Kanton Basel-Stadt trägt der Bund beispielsweise nur 27 Prozent des Defizits. Gar nicht beteiligt er sich am Ortsverkehr, also am öffentlichen Verkehr in Städten, am touristischen Verkehr und am Fernverkehr.
Mit der Erhöhung des Zahlungsrahmens um 1,7 Prozent pro Jahr liegt der Bund unter den Vorstellungen der ÖV-Branche. Diese hatte vergangene Woche gefordert , die öffentliche Hand müsse künftig ihre Abgeltungen um 2,5 bis 3,5 Prozent pro Jahr erhöhen, weil das Angebot ausgebaut werde und die Kosten steigen würden. (ehs)
11:22 Uhr
Mittwoch, 26. Juni 2024
Der Postauto-Chef tritt zurück
Christian Plüss hat das Steuer bei Postauto Ende 2018 in turbulenten Zeiten übernommen, nachdem aufgrund es Subventionsskandals die gesamte Geschäftsleitung von Postauto vor die Tür gesetzt worden war.
Nun hat sich der heute 62-Jährige entschieden, den Chefposten per Ende Januar 2025 wieder abzugeben, wie die Post am Mittwoch bekannt gibt. «Für mich ist damit der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Aufgabe in neue Hände zu geben», hält Plüss fest. Er werde aber nach seinem Rücktritt vom Postauto-Chefsessel und von der Post-Konzernleitung weiterhin für den Staatskonzern tätig sein, und zwar im Bereich Nachhaltigkeit und Energie.
Der Verwaltungsrat der Post wird gemäss eigenen Angaben die Nachfolge von Plüss «in diesen Tagen» in die Wege leiten. (fv)
13:39 Uhr
Dienstag, 25. Juni
Mehr Stau in Schweizer Städten
Der Anbieter von Verkehrsdaten Inrix aus den USA hat am Dienstag sein alljährliches Ranking über die Verkehrssituation für Autofahrende veröffentlicht. Untersucht wurden knapp 1000 Städte auf der ganzen Welt. Am meisten Zeit wegen Stau verlor ein durchschnittlicher Autolenker im vergangenen Jahr in New York City: 101 Stunden zusätzliche Zeit im Auto ging dort auf das Konto der Verkehrsüberlastung. Danach folgen Mexiko City und London.
Inrix berechnet ein Ranking aufgrund von Staustunden und der Grösse der Stadt. In diesem landet Zürich als erste Schweizer Stadt auf Platz 42 weltweit. Im Jahr 2023 verloren durchschnittliche Autofahrerinnen und -fahrer hier 60 Stunden im Stau, 3 Prozent mehr als im Jahr 2022. Die Stausituation ist damit schlimmer als etwa in München, Vancouver oder San Francisco.
Auf dem globalen Platz 93 landet Basel mit 48 Stunden Stau, eine Zunahme um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf Platz 194 findet sich Bern (37 Stunden, +12 Prozent gegenüber 2022), auf Platz 210 Lugano (38 Stunden, +5%) und auf Platz 220 Genf (33 Stunden, +9%). In Luzern verlieren Autofahrende 30 Stunden pro Jahr (+5 Prozent gegenüber 2022, in St. Gallen sind es 22 Stunden. Hier wurde gegenüber dem Vorjahr gar ein Rückgang von 6 Prozent verzeichnet. (ehs)
07:18 Uhr
Dienstag, 25. Juni 2024
Meyer Burger erhält Zulassung für neues Solar-Werk in den USA
Meyer Burger hat die Zulassung für sein neues Werk zur Herstellung von Solarmodulen in den USA erhalten. Wie der in der Schweiz beheimatete Produzent von Photovoltaik-Zellen am Dienstag mitteilt, hat die Fabrik in Goodyear (Arizona) das für den offiziellen Produktionsstart vorausgesetzte Audit bestanden.
Die für die Module benötigten Solarzellen werden laut Meyer Burger vorerst allerdings weiterhin in Deutschland produziert werden. Und der Standort Thalheim werde auch «auf absehbare Zeit benötigt, um den Hochlauf in den USA zu gewährleisten». Dies mindestens bis zum Zeitpunkt, wenn das geplante Solarzellenwerk in Colorado Springs (Colorado) in Betrieb ist.
Wann genau Meyer Burger die Solarzellenfertigung in den USA hochfahren wird, ist allerdings abhängig vom Abschluss einer laufenden Finanzierungs-Runde. Laut dem Solarzellen-Produzenten gibt es jedoch «Fortschritte».
Seit gut einem Jahr verlagert Meyer Burger die Solar-Produktion aus Deutschland in die USA. Dies ist laut dem in der Schweiz beheimateten Unternehmen eine Folge der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, beispielsweise mit Zöllen auf Solarprodukten. (sat)
17:15 Uhr
Montag, 24. Juni 2024
EU nimmt Apple ins Visier
Im Kampf gegen die Macht von Tech-Konzernen hat die EU-Kommission Apple ins Visier genommen. Der US-Konzern steht in Brüssel im Verdacht, gegen neue Regeln für grosse Online-Plattformen verstossen zu haben. So gebe es etwa Zweifel, ob Apple der Verpflichtung nachkomme, Nutzer gebührenfrei auch auf Angebote von Entwicklern ausserhalb des hauseigenen App Stores zu leiten, teilte die Behörde gestern mit. «Wir werden die Angelegenheit untersuchen, um sicherzustellen, dass Apple diese Bemühungen nicht untergräbt», sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die Kommission will unter anderem prüfen, ob die Schritte zulässig sind, die ein Nutzer unternehmen muss, um alternative App Stores oder Apps auf dem iPhone herunterzuladen und zu installieren.
Die EU-Kommission äussert zudem ihre Zweifel daran, dass die sogenannte Kerntechnologiegebühr für Apps von Drittanbietern verhältnismässig sei. Apple hat diese jährlich anfallende Gebühr im März zusammen eingeführt. Sie beträgt 50 Cent für jede Erstinstallation einer App nach Überschreiten der Schwelle von einer Million Downloads in einem Zwölfmonatszeitraum. App-Entwickler können alternativ beim alten Vergütungsmodell bleiben und ihre Anwendungen wie zuvor nur über Apples App Store vertreiben – und dann 15 oder 30 Prozent ihrer digitalen Erlöse an den US-Konzern abtreten.
Apple widerspricht den Vorwürfen der Kommission: In den vergangenen Monaten habe man eine Reihe von Änderungen vorgenommen, um den Forderungen des neuen EU-Gesetzes über digitale Märkte (DMA) zu entsprechen. «Wir sind zuversichtlich, dass unser Plan dem Gesetz entspricht.» Laut Apples Schätzungen müssten mehr als 99 Prozent der Entwickler mit den neuen Geschäftsbedingungen gleich viel oder weniger Gebühren zahlen.
Das DMA ist seit Anfang März in Kraft und soll für mehr Wettbewerb sorgen. (dpa)
10:20 Uhr
Freitag, 21. Juni
USA verbieten Kaspersky-Software
Die russische Cybersicherheitsfirma Kaspersky steht in den USA vor dem Aus. Die Regierung hat ein Verbot der Virenschutz-Software beschlossen, wie eine Unterbehörde des Handelsministeriums mitteilte. Eine «gründliche Untersuchung» habe ergeben, dass die Tätigkeit von Kaspersky «ein unangemessenes oder unannehmbares Risiko für die nationale Sicherheit» darstelle.
Die Behörden nennen dafür mehrere Gründe. Kaspersky sei in der Lage, bösartige Software zu installieren und Updates zurückzuhalten. Dadurch würden Personen und kritische Infrastrukturen in den USA anfällig für Angriffe. Zudem habe die Firma Zugang zu sensiblen Kundendaten. Diese könnte sie möglicherweise nach Russland übermitteln, wo sie nach russischem Recht für die Regierung zugänglich wären.
Kaspersky wehrt sich und ergreift rechtliche Schritte
Kaspersky weist die Vorwürfe entschieden zurück. Man sei davon überzeugt, die Entscheidung sei «aufgrund des derzeitigen geopolitischen Klimas gefallen, nicht basierend auf einer umfassenden Bewertung», schreibt die Firma in einem Statement. Man habe «wiederholt die Unabhängigkeit von Regierungen unter Beweis gestellt». Das Verbot nütze vor allem Cyberkriminellen.
Nun will Kaspersky rechtlich dagegen vorgehen. Man blicke zuversichtlich in die Zukunft und werde sich «auch weiterhin gegen Handlungen wehren, die unseren Ruf und unsere geschäftlichen Interessen in unfairer Weise schädigen».
Die Kaspersky-Software genoss früher international einen guten Ruf beim Virenschutz. Die Sorge, wonach das Programm ein Einfallstor für die russischen Geheimdienste sein könnte, ist aber nicht neu. Seit 2017 dürfen US-Bundesbehörden die Produkte nicht mehr einsetzen. Und nun folgt das generelle Verbot: Ab dem 20. Juli ist der Verkauf der Software an Firmen und Privatpersonen untersagt. Mit Updates ist ab dem 29. September Schluss. Das Handelsministerium empfiehlt «dringend, rasch zu einem anderen Anbieter zu wechseln».
Nach eigenen Angaben ist Kaspersky-Software weltweit auf mehr als einer Milliarde Geräten installiert. Die Firma zählt laut den US-Behörden über 400 Millionen Privatpersonen und 270000 Unternehmen zu ihrer Kundschaft. (aka)
10:10 Uhr
Freitag, 21. Juni
SBB-Personalchef Markus Jordi geht
Markus Jordi wird seine Aufgabe als Personalchef und Mitglied der SBB-Konzernleitung im Verlauf des Jahres 2025 abgeben, sobald seine Nachfolge die Funktion übernimmt. Das teilen die SBB am Freitag mit. Jordi werde per 1. Januar Präsident des Rats der Fachhochschule Nordwestschweiz. Für die Bahn werde er auch künftig einzelne Dossiers verantworten, etwa die Verhandlungen zur Zukunft des Gesamtarbeitsvertrags mit den Sozialpartnern.
Jordi ist seit 17 Jahren Personalchef der SBB. Der 62-jährige hat laut der Mitteilung «massgeblich zur Entwicklung der SBB beigetragen und die Arbeitnehmer-Attraktivität gesteigert». Auch habe er die Sanierung der Pensionskasse verantwortet. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung dankten ihm für sein langjähriges, grosses Engagement. Die Nachfolge ist noch nicht bestimmt. (ehs)
09:41 Uhr
Freitag, 21. juni 2024
Aktionäre stimmen für Aufspaltung der CPH Chemie + Papier
Nun ist die Aufspaltung fix: Die Aktionäre der CPH Chemie + Papier Holding AG haben der Schaffung von zwei unabhängigen Unternehmen mit 98 Prozent zugestimmt. Insgesamt waren an der ausserordentlichen Generalversammlung 78 Prozent der Aktienstimmen vertreten, wie das Luzerner Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.
Damit wird das bisherige Unternehmen wie vom Verwaltungsrat vorgeschlagen in die CPH Group AG und in die Perlen Industrieholding AG aufgeteilt. Während erstere Aktien weiter an der Börse im Handel bleiben, werden Letztere Papiere künftig nur noch ausserbörslich gehandelt.
Bestehende CPH-Aktionär erhalten pro Namenaktie eine Sachdividende in Form einer Namenaktie der neuen Perlen Industrieholding AG. Als erster Handelstag dieser Papiere ist der 25. Juni 2024 vorgesehen. (sat)
17:00 Uhr
Donnerstag, 20. Juni
Knall in der Krankenkassen-Welt: 13 grosse Kassen gründen neuen Verband
Eigentlich sollten sie am selben Strick ziehen, denn schliesslich vertreten Santésuisse und Curafutura beide die Interessen der Krankenkassen. Doch persönliche Animositäten, Verletzungen und Kämpfe schufen ein Klima des Misstrauens und haben in den vergangenen Jahren die gemeinsame Arbeit nur verunmöglicht. Kaum einmal waren die beiden Verbände einer Meinung. Unterstützte der eine Verband eine Reform, wurde sie vom anderen sabotiert. Jüngstes Beispiel ist der Streit um die grosse, dringend nötige Tarifreform im ambulanten Bereich. Nun haben offensichtlich nicht nur die Politiker genug von diesen Streitereien, sondern auch die Verbandsmitglieder: 13 Kassen gründen nun einen neuen Branchenverband, wie sie am Donnerstag bekannt gegeben haben. Diese – noch namenlose – Interessensorganisation soll per 2025 operativ werden.
Zusammen vertreten die 13 Kassen, die jetzt einen Neustart wagen, «mehr als 90 Prozent der Grundversicherten», wie Beni Meier von der KPT ergänzt. Die Berner Krankenkasse, die bereits Ende 2023 Curafutura verlassen hatte und damit etwas freier auftreten kann, hat die Kommunikation für den neuen Verband hat in der Deutschschweiz übernommen.
Ebenfalls mit von der Partie sind die drei Curafutura-Kassen Helsana, CSS und Sanitas. Damit ist die 2013 gegründete Santésuisse-Alternative am Ende und verliert all ihre Mitglieder. Von Seiten Santésuisse machen Assura, Atupri, Concordia, EGK, Groupe Mutuel, ÖKK, Swica, Sympany und Visana mit.
Santésuisse ist mehr als ein Lobbyverband
Santésuisse ist aber bei weitem nicht nur ein Lobbyverband. Mit den Tochterfirmen Sasis undTarifsuisse fungiert Santésuisse als Dienstleistungsunternehmen für die Kassen und stellt etwa die Krankenkassenkarten aus oder führt Tarifverhandlungen mit den Leistungserbringern. Folglich dürften 235 der insgesamt rund 250 Mitarbeitenden nicht oder kaum von der Verbandsneugründung betroffen sein.
Die 9 Gründungsmitglieder aus dem Santésuisse-Lager wollen aber bei ihrem angestammten Verband Mitglied bleiben, jedenfalls bis der neue Verband steht und das Lobbying für die Branche übernehmen kann. Das jedenfalls präzisiert Santésuisse-Chefin Verena Nold auf Anfrage. Und sie betont, dass sie den restlichen rund 25 Santésuisse-Mitgliedern empfohlen hat, sich dem neuen Verband anzuschliessen. «Es ist wichtig, dass unsere Branche mit einer Stimme spricht.»
Ob es wirklich soweit kommt, ob sich die Branche diesmal wirklich zusammenraufen kann, ist offen. Bis anhin sind alle Zusammenarbeitsbemühungen und Fusionsprojekte gescheitert. Zuletzt starteten die damaligen Präsidenten der beiden Verbände Mitte 2022 eine Annäherungsoffensive – unter dem vielversprechenden Namen ZUGEBE, einem Akronym für «Zusammen geht es besser». Doch nach ein paar Monaten war dann wieder Schluss. (fv)
10:16 Uhr
Donnerstag, 20. Juni
Die Verkehrsbetriebe Zürich heben Notfahrplan auf
Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mussten im Dezember 2023 ihren Fahrplan ausdünnen. Wegen Personalmangels fielen zu viele Kurse aus, weswegen das städtische Transportunternehmen am Abend den Fahrplan reduzierte, um dennoch einen stabilen Betrieb zu ermöglichen. Diese Massnahme kann per 15. Dezember dieses Jahres wieder aufgehoben werden, teilen die VBZ am Donnerstag mit.
Dank diverser Massnahmen in der Rekrutierung und Ausbildung habe sich die Personalsituation schrittweise verbessert. Dazu gehörten eine intensivere Rekrutierung oder Verbesserungen in der Gestaltung der Dienstpläne. Konkret wechseln die Tram- und Buslinien in der Stadt Zürich ab Dezember ab 20.30 Uhr wieder vom 7,5-Minuten-Takt auf einen 10-Minuten-Takt statt wie bisher auf den 15-Minuten-Takt. Auf den 15-Minuten-Takt wird wie zuvor üblich um etwa 22.30 Uhr respektive an Wochenenden um Mitternacht gewechselt. Die Absenzen seien allerdings im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weiterhin erhöht, halten die VBZ fest. Zudem würden weiterhin viele Mitarbeitende aus der Babyboomer-Generation pensioniert, weswegen die Rekrutierung intensiv weitergeführt werden müsse.
In den vergangenen Monaten hatten nicht nur die VBZ, sondern auch die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) mit einem Personalmangel zu kämpfen. Diese mussten ebenfalls den Fahrplan ausdünnen, konnten die Massnahme aber dank Neueinstellungen per April wieder aufheben. Noch immer Einschränkungen wegen Personalmangel gibt es hingegen bei der Rhätischen Bahn (RhB). Diese hat noch kein Enddatum der Massnahmen kommuniziert. Der Kanton Graubünden hat vor kurzem mitgeteilt, dass unter anderem wegen der Personalsituation per Dezember dieses Jahres geplante Ausbauten bei der RhB wie der Halbstundentakt zwischen Chur und Ilanz um ein weiteres Jahr verschoben werden könnten. (ehs)
07:37 Uhr
Donnerstag, 20. Juni
Abfallentsorgung: Weko büsst Walliser Unternehmen wegen Absprachen
Bei der Vergabe von Gemeinde-Aufträgen im Entsorgungsbereich ist es im Wallis zu unerlaubten Firmen-Absprachen gekommen. Wie die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) am Donnerstag mitteilt, hat sie ein Unternehmen aus Martigny mit rund 100'000 Franken gebüsst.
Weil die vier fehlbaren Firmen – inklusive dem sanktionierten Unternehmen – mit der Weko kooperieren, gibt es in dem Verfahren keine weiteren Sanktionen. Die Namen der betroffenen Unterwalliser Gemeinden nennen die Wettbewerbshüter nicht.
Wie die Weko schreibt, hat sie bei den drei untersuchten Vergaben mehrerer Unterwalliser Gemeinden in zwei Fällen unerlaubte Firmen-Absprachen festgestellt. Im Weiteren hat die Weko auch eine Kooperationsform von drei Unternehmen im Entsorgungsbereich untersucht. Dabei hat sie zwar keine Verfehlungen festgestellt. Allerdings hätten die Firmen hier Informationen ausgetauscht, welche kartellrechtlich heikel seien.
Die von der Weko ausgesprochene Sanktion ist noch nicht rechtskräftig und kann noch an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden. (sat)
15:41 Uhr
Mittwoch, 19. Juni
Salt lanciert neue Fernseh-Box
Der Mobilfunk-Anbieter Salt bringt eine neue Box fürs Fernsehen auf den Markt. Diese basiert laut einer Mitteilung vom Mittwoch auf dem Android-Betriebssystem. Bisher erhielten die TV-Kundinnen und -kunden von Salt eine Apple-TV-Box, mit der sie fernsehen konnten. Neu können sie zwischen den beiden Möglichkeiten auswählen – oder auf die Box verzichten und eine App nutzen, die für Fernsehgeräte von Samsung, LG sowie Android-basierte Geräte von Sony und Philips erhältlich ist.
Die neue Box besteht laut Salt zu 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Sie biete Ultra-HD-Bildqualität und Dolby-Digital-Plus-Sound. Bereits vorinstalliert seien zahlreiche Apps etwa von Netflix oder Disney+. Weiterhin verfügbar sind die bekannten Funktionen wie das Replay-TV mit einem Archiv von sieben Tagen.
Die neue Box ist ab Mittwoch auf der Salt-Internetseite sowie in den 109 Läden der Nummer 3 im Schweizer Telekom-Markt erhältlich. Neukundinnen und -kunden können ihr bevorzugtes TV-Betriebssystem laut Salt ohne zusätzliche Kosten wählen. (ehs)
06:03 Uhr
Mittwoch, 19. Juni
Statt Microsoft: Nvidia dank KI-Boom an der Spitze im Börsenolymp
Der Boom mit der künstlichen Intelligenz (KI) macht Nvidia zum neuen wertvollsten Unternehmen an der Börse. Chip-Konzern kam am Dienstag auf einen Börsenwert von gut 3,33 Billionen Dollar und überholte damit den Software-Riesen Microsoft.
Nvidia spielt eine Schlüsselrolle für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Mit Chipsystemen des Unternehmens wird KI-Software in Rechenzentren trainiert - und sie werden auch immer mehr für ihren Betrieb eingesetzt. Rivalen wie Intel oder AMD konnten Nvidia bisher keine spürbare Konkurrenz in dem Markt machen.
Mit dem Durchmarsch an die Spitze ist die Nvidia-Aktie das Papier mit der besten Kursentwicklung in den vergangenen 25 Jahren, wie der Finanzdienst Bloomberg errechnete. Seit dem Börsengang 1999 stieg der Wert der Aktie nach Bloomberg-Zahlen inklusive reinvestierter Dividenden um sagenhafte 591'078 Prozent. Mit anderen Worten: Aus einem damals investierten Dollar wurden demnach mehr als 5900. (dpa)
18:07 Uhr
Dienstag, 18. Juni
Beat Imhof ist neu der oberste Wirt der Schweiz
Überraschung im Säli: Die 219 Delegierten von Gastrosuisse haben gestern in Neuenburg den 52-jährigen Beat Imhof zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Imhof setzte sich gegen den als Favoriten gehandelten Vizepräsidenten Massimo Suter durch und folgt damit auf Casimir Platzer, der den Wirte-Verband zehn Jahre lang geführt hat und insbesondere während der Coronapandemie für seinen konfrontativen Kurs auch oft kritisiert worden war.
Imhof ist gelernter Koch, hat in Luzern einen Management-Master gemacht, ist Dozent und seit 2018 Chef des Casinotheaters in Winterthur. (fv)
07:09 Uhr
18. Juni 2024
Komax will in China zukaufen und in der Schweiz die Kurzarbeit ausweiten
Der Kabelmaschinenhersteller Komax leidet weiterhin unter der unbeständigen Situation auf dem Weltmarkt. So dürfte der Umsatz im ersten Halbjahr weiterhin deutlich zurückgehen, wie das weltweit tätige, im Kanton Luzern beheimatete Unternehmen am Dienstag mitteilt. Darum plant Komax, die bestehende Kurzarbeit hierzulande auszuweiten und in China die Mehrheit an einem Konkurrenten zu übernehmen.
Wie die Komax Gruppe schreibt, geht das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte von «einer leichten Verbesserung der Marktsituation aus». Am Ende soll ein Umsatzniveau vergleichbar mit jenem des Vorjahres resultieren. Die definitiven Halbjahreszahlen wird das Unternehmen jedoch erst Mitte August publizieren.
Bis dahin sollen jedoch die Kosten weiter reduziert und die Strukturen optimiert werden, die durch den Zusammenschluss mit Schleuniger entstanden seien. Komax hat zur Kostenreduktion zudem bereits Ende April entschieden, die Produktion bei Komax Testing Bulgaria einzustellen und den deutsche Standort Jettingen zu schliessen.
Um aus der aktuellen «Schwächephase herauszukommen», will die Komax Gruppe die seit Mai in Dierikon (LU) teilweise geltende Kurzarbeit auf den ganzen Standort ausweiten. Zudem solle ab Juli auch in Cham (ZG) Kurzarbeit gelten, sofern die Behörden dem Vorhaben zustimmen.
Zusätzlich zur Optimierung der Strukturen will Komax in China wachsen. Aus diesem Grund plant sie per Juli die Übernahme von 54 Prozent der Aktien des chinesischen Unternehmens Hosver. Dieses ist laut Komax «der führende Hersteller von Maschinen für die Verarbeitung von Hochvoltkabeln» die in Fahrzeugen mit Elektroantrieb benötigt werden. (sat)
05:57 Uhr
Dienstag, 18. Juni 2024
Zurück auf Platz 2: Schweiz legt bei Wettbewerbsfähigkeit zu
In der Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit von 67 Ländern der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD belegt die Schweiz dieses Jahr den zweiten Rang. Platz 1 geht an Singapur, den dritten Platz sichert sich Dänemark. Die Schweiz war in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils auf den Plätzen 1 bis 3 zu finden.
Besonders gut schneidet sie ab bei Faktoren wie den öffentlichen Finanzen, der Bildung oder der Gesundheitsversorgung, wo sie jeweils Platz 1 belegt. Am schlechtesten schneidet die Schweiz in Sachen Preisniveau ab, wo es nur für Platz 61 reicht. In der Befragung von leitenden Angestellten wurde zudem die politische Stabilität und Vorhersehbarkeit am häufigsten positiv genannt, gefolgt von der zuverlässigen Infrastruktur und dem hohen Bildungsniveau.
Schlecht schneidet die Schweiz bei der preislichen Wettbewerbsfähigkeit und dem Indikator «offene und positive Einstellung» ab. Als grösste Herausforderungen für Volkswirtschaften bezeichnet die Hochschule IMD den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und kreislauforientierten Wirtschaft, die Integration von Schwellenländern in die Weltwirtschaft und die digitale Transformation. (ehs)
14:14 Uhr
Montag, 17. Juni
China geht gegen Fleisch-Importe vor
China hat eine Antidumping-Untersuchung gegen importierte Produkte aus der Europäischen Union angekündigt. Sie richte sich gegen eingeführtes Schweinefleisch und Nebenprodukte, teilte das Handelsministerium am Montag mit. Dies dürfte eine Gegenreaktion auf die von der EU angedrohten Strafzölle auf chinesische E-Autos sein. Zuvor hatte die EU-Kommission zu Chinas Subventionen für Elektrofahrzeuge ermittelt, die nach Ansicht Brüssels den Markt in Europa verzerren.
Die chinesische Staatszeitung «Global Times» hatte berichtet, dass die chinesische Industrie Beweise für die Untersuchung gegen bestimmte Milchprodukte und Schweinefleisch aus der EU sammle. Betroffen seien Produkte, die hauptsächlich zum Verzehr durch Menschen gedacht sind – etwa frisches und gefrorenes Schweinefleisch.
Experten hatten nach der Strafzoll-Androhung der EU Gegenreaktionen erwartet. China werde aber keine EU-Produkte mit Zöllen belegen, die es noch brauche, hatte etwa Jacob Gunter vom in Berlin ansässigen Institut Merics gesagt. «Dazu zählen Maschinen, hochwertige Industriegüter, Chemikalien, Medizintechnik und andere Produkte.» Grosse europäische Automobilhersteller dürften verschont bleiben, weil diese Gunter zufolge stark in China investieren, Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und zum Wachstum beitragen. (dpa)
09:00 Uhr
Montag, 17. Juni
Schweizer BIP wächst nur unterdurchschnittlich
Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes rechnet für das Jahr 2024 mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mit. Das um Sportevents bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) soll demnach um 1,2 Prozent zulegen. Die Prognose wurde gegenüber jener vom März damit leicht nach oben korrigiert. Damals wurde noch mit einem Wachstum von 1,1 Prozent gerechnet.
Im ersten Quartal sei das BIP wie in den Vorquartalen moderat gewachsen, heisst es in der Mitteilung. Der Dienstleistungssektor habe neuerlich expandiert, der private Konsum sei «solide» gewachsen. «Aktuell lassen viele Indikatoren ein moderates Wachstum der Schweizer Wirtschaft in naher Zukunft erwarten», schreiben die Fachleute des Seco. Insbesondere der private Konsum stütze das Wachstum.
Die globale Konjunktur habe sich zuletzt sehr unterschiedlich entwickelt: In den USA sei sie merklich abgeschwächt, in Japan sei das BIP im ersten Quartal gar geschrumpft. Im Vereinigten Königreich und in China hingegen wachse die Wirtschaft verhältnismässig stark, auch der Euroraum erhole sich etwas von der vorangegangenen Schwächephase. «Er dürfte sich aber auch in den kommenden Quartalen weiterhin nur verhalten entwickeln, mit entsprechenden bremsenden Effekten auf die exponierten Bereiche der Schweizer Exportwirtschaft». Mit einer allmählichen Erholung der Weltwirtschaft solle sich das Wirtschaftswachstum in der Schweiz im nächsten Jahr auf 1,7 Prozent normalisieren. (ehs)
14:48 Uhr
Samstag, 15. Juni
Migros-Delegiertenversammlung: Die neue Präsidentin heisst Edith Spillmann
Die Delegierten des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) haben am Samstag in Zürich an ihrer ausserordentlichen Sitzung Edith Spillmann zur neuen Präsidentin der Delegiertenversammlung gewählt, wie die Migros mitteilte. Sie wird ihr Amt am 1. Juli antreten.
Die 63-jährige Spillmann arbeitet als Personalverantwortliche bei der zum Berner Stromkonzern BKW gehörenden Firma Arnold und wohnt im zürcherischen Bülach. Sie war acht Jahre lang Mitglied des Migros-Genossenschaftsrats Zürich und ist seit 2020 Mitglied der MGB-Delegiertenversammlung sowie der Arbeitsgruppe des Migros-Unterstützungsfonds.
Spillmann folgt auf Marianne Meyer, die im März nicht wiedergewählt worden war und nun auch beim zweiten Versuch gescheitert ist, ihren Posten zu retten. Nebst Spillmann und Meyer hatten auch der pensionierte Lehrer Dominique Imhof, der mit 66 Jahren gemäss Wahlreglement eigentlich schon zu alt war für die Wahl, und Séghira Egli kandidiert, die bis zum vergangenen Frühjahr im Marketing des MGB gearbeitet hatte und als Personalvertreterin sogar im MGB-Verwaltungsrat sass.
Egli hatte die Migros damals nicht freiwillig verlassen, weshalb ihre Kandidatur fürs Spitzenamt bei der Delegiertenversammlung die Migros-Oberen im Vorfeld äusserst nervös gemacht hatte.
Nun dürften sich die Gemüter wieder etwas beruhigen, da Spillmann das Rennen fürs Präsidium beim Migros-Parlament gemacht hat. Sie ist nun für zwei Jahre gewählt, ihre Amtsperiode endet am 30. Juni 2026. (fv)
17:13 Uhr
Freitag, 14. Juni
Bundesrat will Stromtarif senken
Wer in das Stromnetz investiert, hat Anspruch auf eine Entschädigung. Doch je höher sie ist, desto teurer wird der Strom für die Nutzerinnen und Nutzer. Wie hoch also soll der Zins für das investierte Kapital sein? Dieser umstrittenen Frage hat sich der Bundesrat angenommen. Er hat gestern einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt, wonach die Berechnung des sogenannten WACC (Weighted Average Cost of Capital) angepasst werden soll. Die Änderung soll die Stromverbraucherinnen und -verbraucher ab dem Jahr 2026 um jährlich 127 Millionen Franken entlasten.
Wie der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt, soll der Zins einerseits «genügend Anreize für Investitionen in die Stromnetze» bieten. Andererseits soll er «keine ungerechtfertigt hohe Rendite» für die Kapitalgeber abwerfen. Doch seit längerem werde kritisiert, die geltende Methodik gewähre eine zu hohe Verzinsung.
Der Zins für das Tarifjahr 2025 liegt gemäss der aktuellen Berechnungsmethode bei 3,98 Prozent. Mit der Änderung wären es noch 3,41 Prozent. Dies würde den Stromnetztarif um 0,22 Rappen pro Kilowattstunde senken.
«Anpassung wäre Gift für dringend nötige Investitionen»
Gar nicht erfreut über den Vorschlag ist der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). In einer Reaktion auf den Entwurf schreibt er, der «Angriff auf den WACC» sei «Gift für die dringend notwendigen Investitionen» und widerspreche den Zielen des Stromgesetzes, für das sich das Schweizer Stimmvolk soeben klar ausgesprochen habe. Die Entschädigung müsse «angemessen und vor allem verlässlich» sein. Das gewährleiste die heutige Methodik, die sich bewährt habe. Dagegen stehe eine «politisch motivierte Anpassung» dazu «im diametralen Gegensatz». (aka)
11:33 Uhr
Freitag, 14. Juni
Chefs von Swisscom, Post und SBB bleiben die Topverdiener
Über eine Million Franken: So viel verdienten die Konzernchefs der Post, der SBB und der Swisscom im vergangenen Jahr. Das geht aus den Geschäftsberichten und dem neuesten Kaderlohnreporting über die bundesnahen Betriebe hervor, das der Bundesrat am Freitag gutgeheissen hat. Topverdiener bleibt Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann mit einer Gesamtvergütung von 1,85 Millionen Franken. Im Vergleich zum Vorjahr ist sein Verdienst gleich geblieben.
Auf den weiteren Plätzen folgen Post-CEO Roberto Cirillo und SBB-Chef Vincent Ducrot, die beide etwas mehr als eine Million Franken kassieren. Während der Manager des gelben Riesen gleich viel verdient wie im Vorjahr, erhielt der Lenker der Bundesbahnen mehr Geld. Dank eines höheren Bonus strich er rund 20'000 Franken zusätzlich ein.
Keine Veränderungen gibt es bei den Topverdienern unter den Verwaltungsratspräsidien. Bei der Swisscom, die als börsenkotierte Firma nicht vom Kaderlohnreporting des Bundes erfasst wird, erhält der Präsident Michael Rechsteiner 627'000 Franken. Auf Rang zwei folgt SBB-Präsidentin Monika Ribar mit 295'421 Franken und Post-Präsident Christian Levrat mit 268'245 Franken.
Die Kaderlöhne in bundesnahen Unternehmen hatten in der Vergangenheit mehrfach Anlass für Kritik gegeben. In der Öffentlichkeit stiessen die sehr hohen Entschädigungen auf Unverständnis. Den grössten Unmut weckte der Lohn von Ducrots Vorgänger, Andreas Meyer, der zeitweise deutlich mehr als eine Million Franken einstrich. Trotzdem sprach sich das Parlament gegen eine Lohnobergrenze von einer Million Franken für Kaderangestellte bundesnaher Betriebe aus. Auf taube Ohren stiess die Reform besonders im Ständerat. Die kleine Kammer versetzte ihr 2022 den Todesstoss. (rwa)
07:15 Uhr
Freitag, 14. JUNI
Wechsel in der Konzernleitung der Emmi-Gruppe
Sacha Gerber, Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Emmi-Gruppe zu verlassen. Wie das Unternehmen schreibt, scheidet Gerber aufgrund der Sensitivität der Funktion per sofort aus. Das Unternehmen würde diesen Schritt bedauern. Der ehemalige Finanzchef von Calida war seit 2022 bei Emmi.
Die Nachfolge von Gerber tritt Oliver Wasem an. Der bisherige Head Group Controlling & Investor Relations wird per 1. Juli zum neuen Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Wasem fungiert seit 2021 auch als Präsident der Emmi-Vorsorgestiftung und ist seit 2023 zudem Head Investor Relations. Er habe über die letzten zehn Jahre die Transformation der Finanzfunktion in der Emmi Gruppe massgeblich mitgestaltet und vorangetrieben.
Oliver Wasem war zuvor für die Forbo-Gruppe, PwC und Arthur Andersen im In- und Ausland tätig. Er hat an der Universität Zürich seinen Master in Wirtschaftswissenschaften absolviert und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer. (sfr)
10:20 Uhr
Donnerstag, 13. Juni
CH Media erhält Druckauftrag für «Bote der Urschweiz»
Die Schwyzer Regionalzeitung «Bote der Urschweiz» wird ab 2025 in Aarau gedruckt. Die CH Media Print AG, die zum selben Unternehmen wie dieses Portal gehört, hat den Druckauftrag erhalten, wie der «Bote» am Donnerstag mitteilte. Die Tageszeitung hat eine Print-Auflage von knapp 14'000 Exemplaren und erreicht rund 40'000 Leserinnen und Leser.
Hintergrund ist, dass die Regionalzeitung ihre eigene Druckerei in Seewen SZ per Ende Jahr schliesst. Die Anlage habe das «Ende ihrer Lebensdauer erreicht». Man habe sich gegen eine neue Anlage entschieden. Laut Verleger Hugo Triner wäre eine Investition in zweistelliger Millionenhöhe nötig gewesen. Voraussichtlich neun Personen verlieren durch die Schliessung ihren Job. (aka)
10:08 Uhr
Donnerstag, 13. Juni
Rochaden in der Führungsetage der Swatch-Gruppe
Beim Bieler Uhrenkonzern Swatch Group kommt es zu mehreren Wechseln. Der Verwaltungsrat hat zwei neue Mitglieder in die Konzernleitung gewählt, wie die Swatch-Gruppe am Donnerstag mitteilte. Es sind dies Damiano Casafina, Chef der Produktionsgesellschaft ETA, und Sylvain Dolla, Chef der Marke Tissot und bisheriges Mitglied der erweiterten Konzernleitung. Sie treten ihr neues Amt am 1. September an.
Dafür verabschiedet sich Peter Steiger aus dem Gremium. Nach 35 Jahren beim Uhrenkonzern tritt der Controlling-Chef in den Ruhestand. Er werde aber weiterhin «einzelne Mandate für die Gruppe übernehmen», heisst es weiter. Wer Steigers Position übernimmt, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, erklärte die Swatch-Gruppe auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
Auch die erweiterte Konzernleitung erhält Zuwachs: Roland von Keith, Chef der deutschen Manufaktur Glashütte Original, Stephen De Lucchi, Länderchef von Swatch Hongkong und Macao sowie Alain Villard, Chef der Marke Swatch, stossen hinzu. (aka)
09:58 Uhr
Donnerstag, 13. Juni
Der nächste Migros-Stellenabbau: Nun trifft es die Industrie
Vor knapp einem Monat hat die Migros den Abbau von 150 Stellen bei der Supermarkt-Tochter angekündigt. Nun werden auch die Migros-intern als ineffizient beschriebenen Industriebetriebe gestrafft. «Wie mehrfach kommuniziert», überprüfe die hauseigene Industrie «ihre Strategie und künftige Positionierung innerhalb der Migros-Gruppe», teilt der Detailhandelskonzern auf Anfrage mit. «Am Dienstag, 18. Juni 2024 werden wir in der Migros-Industrie zu den Fortschritten dieser Arbeiten informieren.» Die besagten «Fortschritte» sind in diesem Fall wohl einfach ein anderes Wort für Abbau.
Das Onlineportal «Inside Paradeplatz» spricht von 300 Entlassungen. Die Migros selbst will hierzu keine Stellung nehmen.
Klar ist aber auch, dass das Stellenabbauprogramm bei der Migros noch lange nicht beendet ist. Insgesamt will die Migros 1500 Jobs streichen. Mit den Entlassungen bei der Supermarkt-Tochter wurden «erst» 10 Prozent vom Abbauplan umgesetzt. Zudem werden mit den angekündigten Firmenverkäufen von Hotelplan, Mibelle und Co. rund 6500 Stellen zu neuen Eigentümern wechseln. Total wird also die Migros, die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz, um rund 8000 Stellen schrumpfen. (fv)
09:38 Uhr
Donnerstag, 13. Juni
Zwei neue Mitglieder in Schindlers Konzernleitung
Der Verwaltungsrat von Schindler hat Danilo Calabrò and Vikén Martarian in die Konzernleitung berufen. Calabrò, der seit 2008 in verschiedenen Führungspositionen bei Schindler tätig ist, übernimmt per 1. Juli die Verantwortung für die Region Europa Süd. Er folgt auf Julio Arce, der den Liftkonzern Ende Juni aus persönlichen Gründen verlassen wird.
Martarian übernimmt per 1. Oktober die Leitung der Region Amerika. Er ist seit 2017 bei Schindler und hatte Führungspositionen in Schweden und den USA inne.
Schindlers Konzernleitung setzt sich somit ab Oktober wie folgt zusammen: Silvio Napoli (Verwaltungsratspräsident und CEO), Paolo Compagna (COO und stellvertretender CEO), Matteo Attrovio (CIO), Danilo Calabrò (Europa Süd), Donato Carparelli (CTO), Carla De Geyseleer (CFO), Vikén Martarian (Amerika), Hugo Martinho (Human Resources), Meinolf Pohle (Europa Nord), Robert Seakins (Asien Pazifik) und Daryoush Ziai (China und Fahrtreppen).
Noch immer offen ist, wer den Chefposten von Napoli übernehmen wird; als erster Anwärter wird seit längerem COO Compagna gehandelt. (gr)
17:36 Uhr
Mittwoch, 12. Juni
Flughafen Zürich über 2019er-Niveau
Im Mai sind 2,77 Millionen Menschen über den Flughafen Zürich gereist, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Das sind 9,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und 2,0 Prozent mehr als im Jahr 2019. Die Coronakrise hatte in den Jahren danach für einen Einbruch der Passagierzahlen gesorgt. Allerdings lagen im Jahr 2019 die verkehrsreichen Feiertage Pfingsten und Fronleichnam im Juni, womit ein Teil der Zunahme erklärt werden kann.
In den ersten fünf Monaten nutzten 11,7 Millionen Passagiere den Flughafen, was etwas weniger sind als im bisherigen Rekordjahr 2019 mit 12,0 Millionen Passagieren zwischen Januar und Mai. In Sachen Umsatz liegt der grösste Schweizer Flughafen aber wieder über dem Vorkrisenniveau: In den ersten fünf Monaten wurden auf der öffentlich zugänglichen Seite und hinter der Sicherheitskontrolle in den Geschäften, Restaurants und mit Büromieten 240,8 Millionen Franken umgesetzt und damit gut 8 Millionen Franken mehr als noch 2019.
Im Mai wurden am Flughafen Zürich 23'762 Flugbewegungen gezählt. Das sind 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und 2,8 Prozent weniger als im Mai 2019. (ehs)
15:40 Uhr
Mittwoch, 12. Juni
Langes Warten auf neue Arzneimittel
Der Zugang von Schweizer Patienten zu teils lebenswichtigen Medikamenten hat sich verschlechtert. Dies zeigt die sogenannte WAIT-Studie, die der Verband Interpharma zitiert. Demnach sind auf der Schweizer Spezialitätenliste nur 48 Prozent jener Medikamente aufgeführt, die in der EU zugelassen sind. Die Schweiz rutscht damit im internationalen Vergleich nach hinten auf Platz 6. Alleine im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verschlechterung um sechs Prozentpunkte. In der Schweiz dauert es zudem lange, bis ein neues Medikament von der Obligatorischen Krankenversicherung vergütet wird. Die Wartezeit befindet sich heute auf einem Allzeithoch von über 300 Tagen. Vor diesem Hintergrund müsse der «Preisbildungsprozess» modernisiert werden, so Interpharma. (mpa)
09:03 Uhr
Mittwoch, 12. Juni
SBB beschaffen 116 neue Züge
Die SBB haben am Mittwoch die Beschaffung von 116 neuen Doppelstockzügen ausgeschrieben. Diese sollen in den 2030er-Jahren auf der Zürcher S-Bahn und in der Westschweiz eingesetzt werden. Laut der Bahn handelt es sich um einen Auftrag in Milliardenhöhe. Gut möglich ist, dass es sich gar um die teuerste Beschaffung in der Geschichte der SBB handelt, wie CH Media bereits im vergangenen Jahr berichtete . Diesen Titel hält bisher der 2010 vergebene Kauf von 62 Fernverkehrs-Doppelstockzügen des Typs FV-Dosto, die 1,9 Milliarden Franken kosteten.
Von den 116 Fahrzeugen werden 95 auf der Zürcher S-Bahn eingesetzt und 21 in der Westschweiz. Die Beschaffung umfasst laut einer Mitteilung die Option auf 84 weitere Fahrzeuge. Diese sind laut den SBB nötig für Angebotsausbauten im Rahmen des aktuell laufenden Ausbauschritt 2035 der Bahninfrastruktur.
Die neuen Fahrzeuge werden 150 Meter lang sein und damit länger als die 100 Meter langen sogenannten DPZ-Züge der damaligen Hersteller SLM, SIG, Schindler Waggon und ABB, die sie ersetzen sollen. Bei den DPZ handelt es sich um die Doppelstockzüge der ersten Generation der Zürcher S-Bahn.
Die neuen Züge müssten den Anforderungen der SBB gerecht werden: Dazu gehörten zusätzliche sogenannte Multifunktionszonen ohne Sitze oder nur mit Klappsitzen für Pendlerinnen und Pendler, die für kurze Strecken im Eingangsbereich stehen bleiben möchten, aber auch mehr Platz für Velos, Gepäck und Kinderwagen. Neu seien Steckdosen in der 1. und 2. Klasse vorgesehen, so die SBB.
Interesse haben am Auftrag dürften der Schweizer Bahnbauer Stadler, aber auch Interessenten wie der deutsche Industriekonzern Siemens. Der Chef von Siemens Schweiz hatte vor einem Jahr gegenüber der NZZ kritisiert, es sei schlecht für Innovationen und Investitionen, wenn die SBB «nur noch als Stadler-Bundesbahnen wahrgenommen werden». Die 61 Züge der zweiten Generation der Zürcher S-Bahn kommen bereits von Siemens. Das Unternehmen beschäftigt hierzulande knapp 6000 Mitarbeitende. Die dritte Generation der Zürcher S-Bahn-Züge besteht aus 50 Doppelstöckern von Stadler. ( ehs)
14:10 Uhr
Dienstag, 11. Juni
Es gibt noch viele offene Lehrstellen
Der Lehrstellenmarkt präsentiere sich stabil, schreibt das Bundesamt für Bildung SBFI. Bis Ende Mai 2024 wurden etwas mehr als 53’000 Lehrverträge abgeschlossen. Das sind rund 2’000 mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig melden die Kantone noch knapp 20’000 offene Lehrstellen für den Lehrbeginn 2024. Für Jugendliche, die auf Lehrbeginn 2024 noch keine Lehrstelle haben, sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz also intakt. ( mpa )
08:56 Uhr
Dienstag, 11. Juni
Fostag Formenbau plant Bau einer Hightech-Fabrik
Die Fostag Formenbau AG will nahe ihres Hauptsitzes in Stein am Rhein ein 12’000 Quadratmeter grosses Grundstück kaufen. Mit dieser Investition wolle das Schaffhauser Unternehmen, das sich mit annähernd 100 Mitarbeitenden zu den weltweit führenden Herstellern von Hochleistungs-Spritzgiessformen zählt, die Grundlage für künftiges Wachstum legen. Über den geplanten Grundstückskauf entscheidet der Einwohnerrat der Gemeinde am 28. Juni 2024.
Fostag würde auf dem Bauland «ihre Produktions- und Verwaltungskapazitäten erweitern» und so «auf die steigende Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen reagieren». Auf Anfrage schreibt Fostag-Geschäftsführer und -Mitinhaber Markus Mühlemann, das Unternehmen plane den Bau einer modernen Produktionsstätte mit Hightech-Produktionsanlagen. Über die Kosten für den Grundstückskauf und das Bauprojekt macht Mühlemann noch keine Angaben.
Dafür schreibt Mühlemann auf die Frage, ob mit dem Projekt auch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze verbunden sei, «mit dem Neubau soll auch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden. Damit werden bestehende Arbeitsplätze gesichert und Wachstum und damit neue Arbeitsplätze ermöglicht.» Die Stadt Stein am Rhein begrüsst die geplante Investition der Fostag. (T.G.)
08:51 Uhr
Dienstag, 11. Juni
Medartis-CEO tritt zurück
Medartis hat am Dienstag bekannt gegeben, dass der CEO Christoph Brönnimann zurücktreten und das Unternehmen verlassen will. Er werde aber Medartis weiterhin führen, bis die Nachfolge geregelt sei. Brönnimann hält anlässlich seiner Rücktrittsankündigung fest: «Obwohl mir diese Entscheidung schwer fällt, bin ich stolz auf das, was wir in den letzten fünf Jahren gemeinsam erreicht haben.» Der Verwaltungsrat unter Präsident Marco Gadola wiederum dankt Brönnimann «von ganzem Herzen» für seine Führungsleistung und seine wertvollen Beiträge zum Erfolg von Medartis während seiner Amtszeit. Der Verwaltungsrat hat nach eigenen Angaben die Suche nach seinem Nachfolger eingeleitet. (fv)
08:44 Uhr
Dienstag, 11. Juni
Easyjet baut in Zürich und Basel aus
Die britische Billig-Fluglinie Easyjet baut ihr Angebot ab den Flughäfen Zürich, Genf und Basel aus. Ab Zürich fliegt die Airline ab dem 4. November neu viermal pro Woche nach Manchester und ab dem 2. November zweimal pro Woche nach Bordeaux. Ab Basel nimmt Easyjet ab dem 7. November fünf wöchentliche Flüge an den Flughafen London-Luton auf, ab Genf geht es ab dem 18. Dezember einmal wöchentlich neu nach Leeds Bradford. Die Flüge sind auf der Internetseite der Fluggesellschaft bereits buchbar.
Die Schweizer Tochter Easyjet Switzerland ist am Basler Euroairport die Fluggesellschaft mit dem höchsten Marktanteil. In Basel und Genf betreibt sie eigene Basen mit in der Schweiz registrierten Flugzeugen und hiesigem Personal. Der Flughafen Zürich hingegen wird nur von den ausländischen Easyjet-Töchtern angeflogen. (ehs)
16:09 Uhr
Montag, 10. Juni
Stadler will Bulgarien Züge für eine halbe Milliarde verkaufen
Zwei Monate nach Erhalt des ersten Auftrags aus Bulgarien bewirbt sich der Schienenfahrzeughersteller Stadler erneut um einen Auftrag aus dem osteuropäischen Land. Diesmal geht es um die Beschaffung von 35 einstöckigen elektrischen Triebzügen. In der Anfang 2024 eingeleiteten Ausschreibung hatte das bulgarische Verkehrsministerium einen Preis von 1,1 Milliarden Lew (550 Millionen Franken) ohne Mehrwertsteuer angepeilt. Bestandteil des Vertrags sein soll auch der Service und Unterhalt während 15 Jahren.
Laut dem Ministerium bewerben sich vier Bahnbauer um den Auftrag. Neben Stadler, der mit seiner polnischen Tochtergesellschaft Stadler Polska ins Rennen steigt, sind dies die französische Alstom, die polnische Pesa und die tschechische Škoda. Die neuen Züge müssen Tempo 160 fahren können und mindestens 200 Sitzplätze bieten. Der Kauf der Fahrzeuge wird aus einem nationalen Konjunkturprogramm finanziert.
Im April 2024 hatte Stadler in Bulgarien bereits einen Vertrag im Wert von 300,5 Millionen Lew (150 Millionen Franken) unterzeichnet. Stadler Polska wird dafür sieben elektrische Doppelstöcker des Typs Kiss mit jeweils mindestens 300 Sitzplätzen liefern und das Rollmaterial während 15 Jahren warten. (T.G.)
11:10 Uhr
Montag, 10. Juni
Ferien: eSIM oft günstiger als eigener Anbieter
Wer in den Sommerferien im Ausland mit dem eigenen Smartphone ins Internet gehen will, kommt oft billiger weg mit der Nutzung einer eSIM als mit Datenpaketen des eigenen Anbieters. Das hat der Anbieter Dschungelkompass zusammen mit der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) berechnet, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.
Wer beispielsweise bei den Anbietern Better Roaming oder Airalo ein Datenpaket mit 3 GB kauft, das während 30 Tagen in 39 Ländern Europas gültig ist, bezahlt dafür umgerechnet 9 respektive 12 Franken. Bei Salt kostet ein 3GB-Datenpaket für 30 Länder Europas hingegen 34.95 Franken, bei Wingo und M-Budget mit 40 Ländern inbegriffen gar 42.90 Franken. Allerdings sind beide Pakete ein Jahr lang gültig. Die Swisscom wiederum verlangt für ein 365 Tage gültiges Datenpaket für 40 Länder Europas mit 1 GB Volumen 14.90 Franken.
Um ein solches Angebot nutzen zu können, muss das eigene Handy virtuelle SIM-Karten, sogenannte eSIM, unterstützen. Dabei wird keine physische SIM-Karte in das Handy eingesetzt, sondern ein QR-Code gescannt. Bei vielen Handys kann die physische SIM-Karte des eigenen Anbieters etwa fürs Telefonieren genutzt werden und die eSIM eines externen Anbieters gleichzeitig fürs Surfen im Ausland. (ehs)
10:55
Montag, 10. Juni
Neue Studie: Kaufen bald wieder günstiger als Mieten
Käuferinnen und Käufer von Wohneigentum würden aktuell mehr zahlen als Mieter für eine ähnliche Wohnung, schreiben die Ökonomen der Grossbank UBS in einem Bericht. Der Aufschlag für eine typische Wohnung betrage im nationalen Durchschnitt derzeit 7 Prozent. Doch werde sich dies bald ändern.
Denn die Zinsen sinken, während die Mieten stark steigen. Heute schon ist der Aufschlag, den Käufer bezahlen, deutlich tiefer als noch im Sommer 2023, als er gemäss UBS ungefähr 16 Prozent betrug. Und Ende 2024 werde das Kaufen von Wohneigentum sogar wieder günstiger sein als das Mieten.
Kaufen ist günstiger als Mieten: Das galt schon in den Jahren von 2008 bis Ende 2021, als die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Leitzins ständig tiefer ansetzen musste und ab Ende 2014 gar unter 0 Prozent. Kaufen wurde vorübergehend wieder teurer als Mieten, als die SNB im Jahr 2022 eine Zinswende nach oben einleiten musste, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen.
Nun scheint diese Phase also schon wieder zu Ende zu gehen. Kaufen ist abermals günstiger als Mieten - sofern man das nötige Kapital dafür aufbringen kann. Dies können allerdings immer weniger Menschen, nachdem die Preise über 20 Jahre lang fast durchgehend gestiegen sind. (nav)
06:30 Uhr
Freitag, 7. Juni
Sammelklage gegen die Schweiz in New York
Vor einem Zivilgericht in New York ist im Zusammenhang mit dem Untergang der Credit Suisse eine Sammelklage eingereicht worden. Eingeklagt worden ist dabei die Eidgenossenschaft. Hinter der Klage steht die international grösste Wirtschaftskanzlei Quinn Emanuel. Sie vertritt eine Gruppe von Personen und Investoren.
Im Zentrum der Klage steht der Beschluss des Bundesrats vom 19. März 2023, per Notrecht nachrangige CS-Obligationen (sogenannte AT1-Anleihen) mit einem Gesamtwert von rund 17 Milliarden Franken auf Null abzuschreiben. Die Obligationäre wurden damit gegenüber den CS-Aktionären schlechter gestellt. Gemäss «Tages-Anzeiger» verlangen die Kläger eine Entschädigung von insgesamt 82 Millionen Franken.
Grund für die vergleichsweise tiefe Summe: Zur Sammelklage zugelassen sind nur betroffene Obligationäre, welche in der Schweiz noch keine Klage eingereicht haben. Hierzulande sind beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Hunderte von Klagen gegen den bundesrätlichen Notrechtsbeschluss eingegangen, darunter auch von Grossobligationären wie etwa der Migros-Pensionskasse.
Gegenüber Radio SRF sagte Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz von der Universität Bern am Freitagmorgen, gemäss seiner Einschätzung seien die juristischen Argumente der Kläger relativ schwach. Eine Verurteilung der Schweiz aufgrund der vorliegenden Fakten halte er für eher unwahrscheinlich. (cbe)
15:40 Uhr
Donnerstag, 6. Juni
Saubere Energie übertrumpfen fossile Brennstoffe
Dieses Jahr werden die Investitionen in die weltweite Energieinfrastruktur erstmals 3 Billionen Dollar übertreffen, schreibt die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem neuesten Bericht. Ungefähr 2 Billionen davon würden in saubere Technologien fliessen wie erneuerbare Energien, Elektrovehikel, Nuklearenergie, Stromspeicherung, Netzwerke oder Wärmepumpen. Die übrige Billion Dollar gehe in Kohle, Gas und in Erdöl.
Damit seien die Investitionen in saubere Technologien fast doppelt so hoch gewesen wie jene in fossile Brennstoffe. Dies sei unter anderem deshalb möglich gewesen, weil die globalen Lieferketten wieder besser funktionierten und die Herstellkosten von sauberen Technologien stark gesunken seien. Vor allem die Fotovoltaik habe gigantische Summen angezogen. ( nav )
14:35 Uhr
Donnerstag, 6. Juni
Erstmals seit Inflationswelle: EZB senkt Zinsen
Mit einer Serie von Zinserhöhungen hat sich die EZB gegen die stark gestiegene Inflation gestemmt. Jetzt steuert die Notenbank um - obwohl die Teuerungsrate zuletzt wieder etwas angezogen hat.
Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt nach ihrer beispiellosen Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation wieder die Zinsen im Euroraum. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringern die Euro-Währungshüter den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Das teilte die Notenbank in Frankfurt am Donnerstag im Anschluss an eine Sitzung des EZB-Rates mit. Zugleich wird der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, von 4,5 Prozent auf 4,25 Prozent gesenkt.
Volkswirte hatten mit einer Lockerung der geldpolitischen Zügel gerechnet, nachdem die Inflation sich deutlich abgeschwächt hatte. Zwar hat die Teuerung im Euroraum im Mai wieder etwas an Tempo gewonnen: Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent nach 2,4 Prozent im April. Vom Rekordhoch bei 10,7 Prozent im Herbst 2022 ist die Inflation inzwischen aber weit entfernt. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern. Sie können sich dann für einen Euro weniger leisten.
Die EZB strebt für den Euroraum mittelfristig eine jährliche Inflationsrate von zwei Prozent an. Bei diesem Wert sehen die Währungshüter Preisstabilität gewährleistet. «Wir sind mit dem spürbaren Rückgang der Inflation zufrieden, aber der Weg zurück zur Preisstabilität ist holprig», hatte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel unlängst ARD Plusminus und tagesschau.de gesagt.
Um die nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stark gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen, hatte die EZB seit Juli 2022 zehnmal in Folge die Zinsen nach oben geschraubt, ehe sie eine Pause einlegte. Kredite werden damit teurer. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Teurere Finanzierungen sind zugleich eine Last für die Wirtschaft und Privatleute, die sich Geld leihen wollen. Das kann die Konjunktur bremsen. ( dpa )
10:22 Uhr
Donnerstag, 6. Juni
Steiner AG reicht Gesuch für provisorische Nachlassstundung ein
Die Steiner AG hat beim Bezirksgericht Zürich ein Gesuch für eine provisorische Nachlassstundung eingereicht. Das geht aus einer Mitteilung des Immobiliendienstleisters hervor.
Das Unternehmen sieht sich demnach mit einem Liquiditätsengpass konfrontiert, den es auf den Ausstieg aus dem Generalunternehmer-Geschäft zurückführt. «Um zu verhindern, dass diese Risiken das profitable und erfolgreiche Geschäft der Immobilienentwicklung beeinträchtigen, hat die Steiner AG beim Gericht eine provisorische Nachlassstundung für vier Monate beantragt», heisst es weiter. Ziel dieser Massnahme sei es, die Position aller Beteiligten, insbesondere der Gläubiger, zu stärken.
Die Steiner AG beschäftigt rund 160 Mitarbeitende und führt derzeit nach eigenen Angaben Immobilienentwicklungsprojekte im Wert von rund 5 Milliarden Franken. Im Verwaltungsrat findet sich auch FDP-Mann und Profi-Verwaltungsrat Andreas Schmid, der unter anderem 23 Jahre lang Präsident der Flughafen Zürich AG war. ( cri, chm)
09:25 Uhr
DONNERSTAG, 6. Juni
Neuer Rekord im Wintertourismus
Das Bundesamt für Statistik vermeldete am Donnerstag die Hotelübernachtungen in der Wintersaison 2023/24. Demnach habe die Schweizer Hotellerie den Rekord von 2022/23 nochmals übertroffen und mit 18,0 Millionen Logiernächten einen «neuen historischen Höchstwert» erreicht. Gegenüber der Vorjahresperiode war es eine Zunahme von 2,9 Prozent bzw. von 504'000 Logiernächten.
Das Wachstum kam vor allem von der ausländischen Nachfrage, die um 6,0 Prozent auf 8,7 Millionen Logiernächte zunahm (+491'000 Logiernächte). Hingegen stieg die inländische Nachfrage nur wenig, und zwar um 0,1 Prozent beziehungsweise 13'000 Logiernächte. Damit wurden 9,3 Millionen Logiernächten erreicht und der bisherige Rekordwert der letzten Wintersaison wurde knapp überschritten. (nav)
09:10 Uhr
Donnerstag, 6. Juni
Die Schweizer Bevölkerung im Reisefieber
Trotz Inflation und gestiegenen Reisekosten grassiert in der Schweiz das Ferienfieber. Gemäss einer repräsentativen Umfrage des Online-Vergleichsportals Comparis wollen 92 Prozent der Erwachsenen in diesem Jahr mindestens einmal in die Ferien verreisen, mehr als die Hälfte sogar dreimal. Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung gibt an, für den längsten Urlaub mehr als 1000 Franken auszugeben. «Das hohe Lohnniveau in der Schweiz ermöglicht es den meisten Menschen, mehrmals im Jahr zu verreisen. Trotz gestiegener Preise sind die Reisekosten im Verhältnis zum Einkommen gering», sagt Comparis-Mobilitätsexperte Adi Kolecic. Die meisten grossen Ferien verbringen die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. (kä)
8:42 Uhr
Donnerstag 6. Juni
Arbeitslosenquote im Mai weiter bei 2,3 Prozent
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat am Donnerstag die Arbeitslosenzahlen für den Monat Mai veröffentlicht. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich demnach gegenüber dem Vorjahresmonat um 17'389 Personen. Das entspricht einer Zunahme um 19.7 Prozent. Das war jedoch nicht genug, um auch die Arbeitslosenquote zu erhöhen, diese verblieb bei 2.3 Prozent. Das Seco berichtet über die registrierte Arbeitslosigkeit. Gemeint sind damit Arbeitslose, die bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registriert sind. (nav)
13:06 Uhr
Dienstag, 4. Juni
Migros verkauft ihr Brillen- und Hörgeräte-Geschäft
Der Ausverkauf bei der Migros geht weiter. Der Detailhändler veräussert seine Tochtergesellschaft Misenso, die an 25 Standorten Brillen und Hörgeräte verkauft, an die Neuroth-Gruppe. Misenso bleibe als Marke und eigenständiges Unternehmen bestehen, heisst es in einer Medienmitteilung. Zudem werde die geplante Expansion an weiteren Migros-Standorten fortgeführt.
Als treibende Kräfte hinter Misenso gelten Ex-Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen und seine ehemalige Personal- und Kommunikationschefin Sarah Kreihenbühel. Letztere war 2018 vom Hörgeräte-Riesen Sonova zur Migros gestossen. Fünf Jahre später verliess sie die Genossenschaft - kurz vor dem Abgang Zumbrunnens - und wechselte zum Industriekonzern Kühne + Nagel.
Misenso wurde 2020 gegründet und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende, in erster Linie in so genannten Shop-in-Shops in Migros-Supermärkten sowie in eigenen Geschäften in Migros-Einkaufszentren. Die Neuroth-Gruppe mit Sitz in Graz, Österreich, blickt derweil auf eine 115-jährige Geschichte zurück, ist europaweit tätig und betreibt allein in der Schweiz rund 85 Hörcenter.
Die Migros betont, dass der Gesundheitsbereich für sie auch nach dem Verkauf von Misenso eines der vier strategischen Geschäftsfelder bleibt, neben Lebensmitteln, «Non Food» und Finanzdienstleistungen. So verfolge die Medbase-Gruppe eine Wachstumsstrategie mit Fokus auf die integrierte medizinische Grundversorgung. (bwe)
09:46 Uhr
Dienstag, 4. Juni
Grossauftrag für Stadler aus Ungarn
Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler hat kürzlich aus Ungarn einen Auftrag zur Lieferung von neun elektrischen Intercityzügen des Typs Flirt erhalten. Der Wert beträgt laut einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt 165,5 Millionen Euro (162 Millionen Franken). Der Vertrag mit dem Bahnbetreiber Gysev enthält zudem eine Option zur Lieferung von bis zu vier zusätzlichen Zügen.
Stadler muss das erste Fahrzeug binnen 36 Monaten liefern. Gysev will die Züge ab 2027 auf den Strecken Budapest–Sopron und Budapest–Szombathely einsetzen. Sie sollen später auch für den Verkehr in Österreich zugelassen werden. Die Aluminium-Wagenkasten der fünfteiligen Züge werden in Stadlers ungarischem Produktionswerk in Szolnok gefertigt.
Finanziert wird der Kauf der Züge durch Gysev mit Hilfe eines Darlehens der Europäischen Investitionsbank (EIB). Gysev betreibt bereits eine Flotte von 20 Stadler-Flirt, die zwischen 2013 und 2018 beschafft worden sind. Weitere 123 Flirt sind bei der staatlichen ungarischen Bahngesellschaft MÁV-Start im Einsatz. (T.G.)
09:01 Uhr
Dienstag, 4. Juni
Post: 1,7 Prozent mehr Lohn
Die Post hat sich mit den Personalvertretungen von Syndicom und Transfair auf eine Lohnerhöhung rückwirkend per 1. April geeinigt. Für generelle und individuelle Lohnmassnahmen stehen insgesamt 1,7 Prozent der Lohnsumme zur Verfügung. Das teilte die Post am Dienstag mit. Der Mindestlohn steigt um 893 Franken auf rund 4100 Franken pro Monat. Die Ober- und Untergrenzen der Lohnbäder im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) werden um 1,7 Prozent angehoben.
Von den Lohnerhöhungen betroffen sind rund 28'300 Mitarbeitende, die dem GAV unterstehen - davon 25'500 bei der Post und 2'800 bei Postfinance. Parallel zu den Lohnverhandlungen finden weiterhin Gespräche der Sozialpartner zu einem neuen GAV statt. (ehs)
08:37 Uhr
Dienstag, 4. Juni
Inflation steigt wieder
Im Mai sind die Preise der im Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) zusammengefassten Güter um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug die Teuerung 1,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Schon im April war die Teuerung gegenüber dem Vorjahresmonat auf diesem Niveau. Der LIK erreichte im Mai den Stand von 107,7 Punkten (Dezember 2020 = 100).
Der Anstieg sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die höheren Preise für Wohnungsmieten und Pauschalreisen ins Ausland. Ebenfalls gestiegen seien die Preise für diverse frische Gemüse sowie für Benzin. Gesunken seien hingegen die Preise für Heizöl, ausländischen Rotwein oder die Parahotellerie.
Der Mietpreisindex stieg im Mai 2024 im Vergleich zum Vorquartal um 1,0 Prozent und gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 3,4 Prozent. Die Anhebung des Referenzzinssatzes für Mietverhältnisse im Juni und Dezember 2023 ziehe Mietpreissteigerungen nach sich, heisst es in der Mitteilung des BFS. Die zweite Erhöhung wirke sich nun im Mai 2024 erstmals auf die Resultate des Mietpreisindexes aus, der ebenfalls in den LIK einfliesst. 19 Prozent der im Mai neu erfassten Mietverhältnisse wiesen demnach eine Mietpreiserhöhung aus. (ehs)
08:13 Uhr
Dienstag, 4. Juni
Mehr Umsatz bei Burckhardt Compression
Der Kompressorenhersteller Burckhardt Compression vermeldet gute Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023: Der Umsatz stieg um 18,4 Prozent auf 982,0 Millionen Franken, der Betriebsgewinn (Ebit) um 27,8 Prozent auf 121,4 Millionen Franken und der Gewinn pro Aktie um 29,0 Prozent auf 26.63 Franken. Das Unternehmen aus Winterthur schlägt nun eine Dividende von 15.50 Franken pro Titel vor, was einer Steigerung von 29,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Rückläufig war der Bestelleingang: Er ging um 11,3 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken zurück. Um Währungseffekte bereinigt betrug das Minus 6,2 Prozent. Laut der Mitteilung vom Dienstag habe eine «Normalisierung der aussergewöhnlich hohen Aktivitäten» stattgefunden, die im Vorjahr im Zusammenhang mit Flüssigerdgas-Tankern im Marinesegement beobachtet worden seien.
Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Burckhardt mit einem Umsatz zwischen 1,0 und 1,1 Milliarden Franken. Die Ebit-Marge soll sich auf einem ähnlichen Niveau wie vergangenes Jahr bewegen. Die Umsatzprognose für das Jahr 2027 wurde um 100 Millionen Franken auf 1,2 Milliarden Franken erhöht.
Die 1844 gegründete Burkchardt Compression ist im Bereich der Kompressorlösungen für Energieversorger tätig. Die Systeme des Unternehmens werden etwa in den Bereichen Chemie, Gastransport oder Wasserstoff-Mobilität eingesetzt. Burckhardt beschäftigt in über 80 Ländern gut 3200 Mitarbeitende. (ehs)
06:37 Uhr
Dienstag, 4. Juni
Finma-Chef will «Naming and Shaming»
Der neue Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) Stefan Walter will mehr Kompetenzen und Instrumente für seine Behörde. Das brauche es, um in der Aufsicht effektiv zu sein, sagt er der NZZ . Im Extremfall müsse die Finma die Möglichkeit haben, einzelne Personen verantwortlich zu machen und «wenn nötig, zu entfernen». Die Finma stand nach dem Untergang der Credit Suisse in der Kritik, nicht früh und entschieden genug eingegriffen zu haben.
Zwar kann die Finma bereits heute hochrangigen Bankvertretern die Gewähr entziehen. Diese können dann einzelne Positionen nicht mehr wahrnehmen. Die Hürde, um einzelnen Personen Verantwortung zuzuweisen, ist laut Walter aber «sehr hoch». Darum brauche es ein «Senior-Manager-Regime», um früher und stärker eingreifen zu können, wenn Warnsignale vorliegen. Damit könne man die verantwortliche Person im Management direkt angehen und auch auf die Vergütung einzelner Manager Einfluss nehmen.
Zudem fordert die Finma, dass sie Bussen gegen einzelne Banken aussprechen kann. Diese müssten hoch genug sein, um nicht einfach als Teil des Geschäftsaufwandes verbucht werden zu können, sagt Walter. Sie müssten veröffentlicht werden können, um einen «Naming and Shaming»-Effekt zu haben. (ehs)
12:16 Uhr
Montag 3. Juni
Reiseveranstalter FTI meldet Insolvenz an
Europas drittgrösster Reisekonzern FTI ist in die Pleite gerutscht. Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI Group, stelle beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, teilte das Unternehmen mit. «Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die bereits angetretenen Reisen auch planmässig beendet werden können». Noch nicht begonnene Reisen würden voraussichtlich ab morgigen Dienstag nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können. Vom Insolvenzantrag unmittelbar betroffen ist den Angaben zufolge zunächst nur die Veranstaltermarke FTI Touristik. In der Folge würden aber auch für weitere Konzerngesellschaften entsprechende Anträge gestellt. (dpa)
11:06 Uhr
Montag, 3. Juni
Kurt Fuchs verlässt Postfinance im Mai 2025
In der Geschäftsleitung bei Postfinance kommt es wieder zu einem Wechsel: Der langjährige Finanzchef und Übergangs-CEO Kurt Fuchs hat per Mai 2025 seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt, wie das Tochterunternehmen der Post am Montag bekannt gab. Fuchs hatte diesen Schritt gemäss Postfinance «seit längerer Zeit geplant» und entschieden, dass mit Beginn der neuen Strategieperiode der richtige Zeitpunkt gekommen sei.
Bereits per Juli 2024 gibt Fuchs den CEO-Posten ab. Dann übernimmt, wie schon früher bekannt gegeben, Beat Röthlisberger den Chefposten. (fv)
09:11 Uhr
Montag, 3. Juni
Roaming: Swisscom am günstigsten
In den Ferien gehört das Surfen und Telefonieren mit dem eigenen Smartphone für viele dazu. Dabei können allerdings hohe Roaming-Kosten entstehen. Der Vergleichsdienst Moneyland hat die Angebote Schweizer Telekom-Firmen verglichen. Der Referenzfall waren Kundinnen und Kunden, die innert eines Jahres viermal in EU-Länder verreisen: für zwei Wochen in die Sommerferien, eine Woche in die Herbstferien und zwei viertägige Städtereisen. Dabei unterstellt der Vergleichsdienst ein verbrauchtes Datenvolumen von 6 Gigabyte und 120 Minuten Telefonate.
Im Vergleich schneidet die Swisscom am günstigsten ab. Für die Nutzung entstehen Kundinnen und Kunden des grössten Anbieters Kosten von 86.60 Franken. Auf Platz zwei folgt Swype, ein Digital-Ableger von Sunrise. Dort werden 87 Franken fällig. Das Aldi-Abo schafft es mit Kosten von 89.60 Franken ebenfalls aufs Podest, unter 100 Franken Kosten entstehen zudem bei den Anbietern M-Budget und Wingo. Deutlich teurer ist Sunrise, wo 139.50 Franken fällig werden. Wer ein Yallo-Prepaid-Abo besitzt, bezahlt gar 160 Franken, Kundinnen und Kunden mit einem Lebara-Abo müssen 170 Franken auf den Tisch legen.
Bei manchen Anbietern hängen die Kosten laut dem Artikel aber auch stark vom jeweiligen EU-Land ab. Dazu gehört etwa Salt. Die Kosten seien bei der Nummer 3 aber «in jedem Fall eher hoch»: «Kundinnen und Kunden bezahlen für den Warenkorb je nach Land zwischen 133.50 und 367.90 Franken».
Der Vergleich mit den Vorjahren zeige zudem, dass die Preise bei vielen Anbietern gesunken sind. So seien die Datenroaming-Pakete von Sunrise 22,8 Prozent günstiger als noch im Sommer 2023. Auch M-Budget und Wingo hätten die Preise spürbar reduziert.
Den vollständigen Vergleich hat Moneyland online veröffentlicht . (ehs)
08:18 Uhr
Montag, 3. Juni
Keine höheren Mieten – Referenzzinssatz bleibt unverändert
Mieterinnen und Mieter können wenigstens ein bisschen aufatmen. Das Wohnen wird in den nächsten Monaten nicht (noch) teurer. Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt bei 1,75 Prozent, wie das Bundesamt für Wohnungswesen am Montag mitteilt.
13:31 Uhr
Freitag, 31. Mai
UBS-Übernahme ist vollzogen: Credit Suisse AG existiert seit heute nicht mehr
438 Tage nach der von Bund, Nationalbank und Bankenaufsicht Finma orchestrierten Not-Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die Konkurrentin UBS ist klar: Die Fusion der beiden Schweizer Grossbanken ist vollständig vollzogen. Das teilt die UBS am Freitag mit.
Dank «tatkräftiger Unterstützung der Aufsichtsbehörden weltweit» habe der Vollzug der Grossbanken-Fusion «innerhalb des erwarteten Zeitrahmens» umgesetzt werden können, schreibt die UBS. Denn offiziell war die grösste Banken-Übernahme in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte rechtlich gesehen ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen, also keine Übernahme.
Der Abschluss der Übernahme bedeutet jedoch nicht, dass beispielsweise das CS-Logo bereits überall von der Bildfläche verschwunden wäre. «Die Credit Suisse AG wurde heute aus dem Handelsregister des Kantons Zürich gelöscht», schreibt die UBS. Sprich: Die CS existiert seit Freitag einfach nicht mehr als separate Rechtseinheit innerhalb des UBS-Konzerns.
Alle Rechten und Pflichten der einstigen Konkurrentin sind mit dem Vollzug der Fusion damit definitiv auf die UBS übergegangen. Dazu zählen insbesondere auch alle ausstehenden Anleihen der einstigen Credit Suisse AG, wie die UBS in ihrer Mitteilung weiter schreibt.
Juristisch und politisch ist die Fusion respektive Zwangs-Übernahme allerdings noch längst nicht vollständig aufgearbeitet. Einerseits sind nach wie vor mehrere Streitigkeiten vor Gerichten hängig. So wehren sich insbesondere einstige Aktionäre und Investoren der Credit Suisse gegen die von den Behörden auferzwungenen Fusions-Bedingungen.
Andererseits harrt auch die politische Aufarbeitung noch immer ihrer Dinge. Nach bereits publizierten Berichten der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht zu ihrer Sicht auf die Zwangs-Fusion hat laut jüngsten Informationen inzwischen auch die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) von National- und Ständerat ihre Anhörungen kürzlcbeendet. Noch dieses Jahr will dann auch sie noch ihren Bericht zum Untergang der Credit Suisse veröffentlichen. ( sat )
09:08 Uhr
Freitag, 31. März
BFS: Detailhandel im Plus, Dienstleister im Kriechgang
Die Umsätze im Detailhandel steigen weiter. Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilt, sind die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent auf gestiegen. Gegenüber dem Vormonat beträgt das Plus der realen Detailhandelsumsätze 0,2 Prozent.
Der Dienstleistungsbereich befindet sich derweil weiterhin insgesamt im Kriechgang. Wie das BFS ebenfalls am Freitag mitteilt, sind die bereinigten Dienstleistungsumsätze im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8 Prozent gefallen. Zu dieser Entwicklung habe «hauptsächlich der Grosshandel beigetragen», schreibt das BFS.
Mit einem Minus von 17 Prozent besonders stark eingebrochen sind dabei die Umsätze im Bereich «Handel». Ein weiterer, besonders stark vom Rückgang betroffener Wirtschaftsbereich ist «Verkehr und Lagerei» (-8,1 Prozent). Positiv entwickelt haben sich derweil die Bereiche «Reisebüros und Reiseveranstalter» (+50,5 Prozent), «Informationstechnologie» (+33,5 Prozent) sowie «Information und Kommunikation» (+20,1 Prozent).
Das Umsatz-Plus im Detailhandel ist dabei laut BFS zu gleichen Teilen auf die Bereiche Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (plus 2,7 Prozent) zurückzuführen. Im Nicht-Nahrungsmittelsektor sind die Umsätze im März derweil um 2,6 Prozent gestiegen. (sat)
07:41 Uhr
Freitag, 31. Mai
Avec, K Kiosk und Press & Books setzen bei Eigenmarken auf Nutri-Score und Eco-Score
Nächstes Kapitel im Tauziehen um den Nutri-Score: Nachdem der Detailhändler Migros und die Milchverarbeiterin Emmi entschieden haben, die Lebensmittel-Ampel von ihren Produkten wieder zu verbannen, entscheidet sich Valora gerade für den umgekehrten Weg.
Wie die Betreiberin von insgesamt über 1100 Avec-Shops, K Kiosks oder Press & Books-Shops am Freitag mitteilt, sollen alle Produkte der Eigenmarken «ok.–» und «READY TO GO» künftig sowohl den Nutri-Score als auch den Eco-Score enthalten. Dies mit dem Ziel, für Konsumentinnen und Konsumenten in den Bereichen Gesundheit und Nachhaltigkeit möglichst viel Transparenz zu schaffen, wie es heisst.
Dank der in der Schweiz erstmaligen Kombination der beiden Scores könnten Konsumenten «noch besser vergleichen und fundiertere Kaufentscheide treffen», wird Roger Vogt, CEO Retail bei Valora, in der Mitteilung zitiert. Während der ursprünglich aus Frankreich stammende Nutri-Score bereits in zahlreichen europäischen Ländern angewendet wird, ist der Eco-Score noch weniger stark verbreitet.
Wie Valora schreibt, sollen der Nutri-Score und der Eco-Score auf den Produkten der Eigenmarken schrittweise eingeführt werden. Migros und Emmi haben derweil vor Wochenfrist ihre Entscheide bekannt gemacht, die Lebensmittel-Ampel von ihren Produkten wieder zu verbannen. Der orange Riese begründete den Entscheid seinerseits mit zusätzlichen Kosten für die Kennzeichnung der Produkte und einem angeblich tiefen Nutzen. Kritik für den Entscheid erntete die Migros namentlich vom Konsumentenschutz.
In der vergangenen Frühjahrssession hat sich zudem auch die Politik in die Debatte um den Nutri-Score eingeschaltet. Im März überwies der Ständerat eine Motion seiner vorberatenden Kommission für Wirtschaft, Bildung und Kultur an den Bundesrat. Deren Ziel: Die Landesregierung solle präzisieren, wie der Nutri-Score zum Einsatz kommen darf. (sat)
06:44 Uhr
Freitag, 31. Mai 2024
Kein Jahresabschluss: Börse büsst Youngtimers AG mit 200'000 Franken
Teure Post aus Zürich: Die Sanktionskommission der Schweizer Börse (SER) büsst das Basler Unternehmen Youngtimers AG mit 200'000 Franken. Wie die SER am Freitag in einer Mitteilung schreibt, erfolgt die Busse «wegen einer vorsätzlichen Verletzung der Vorschriften zur Rechnungslegung» – konkret fehlt für das Jahr 2022 ein Abschluss. Wie die Börsenaufsicht weiter schreibt, hat sich die Youngtimers AG nicht gegen die Busse gewehrt, womit diese inzwischen rechtskräftig ist.
Die SER hat bereits Anfang Jahr über die Eröffnung einer Untersuchung gegen die Youngtimers AG informiert. Nach Abschluss des Verfahrens habe die Sanktionskommission der SIX Group AG bereits am 13. März 2024 die Busse beschlossen. Bei der Festsetzung der Höhe hat die SER laut eigenen Angaben auch die Auswirkungen der Sanktion auf den Betroffenen und das Verhalten in den vergangenen Jahren berücksichtigt.
Die heutige, börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Youngtimers AG, ist 1998 gegründet worden. Sie hiess einst EL5 und agierte von Genf aus erfolglos im Energiebereich. Daraus wurde dann TheNative – eine Beteiligungsholding, die ohne erkennbaren Erfolg Digitalprojekte lancierte.
Darauf war die Firma einige Zeit ohne Aktivität – ehe sie von einem ehemaligen Manager mit Honorarforderungen in Zwangsliquidation gebracht wurde. Doch diese Altlasten sind längst bereinigt. Und so gab die Youngtimers AG zuletzt denn auch mehr zu reden wegen derer illustrer Mitbesitzer und glamouröser Geschäftsaktivitäten . (sat)
13:25 Uhr
Donnerstag, 30. Mai
Migros stellt ihren Einkauf neu auf
Die Migros will im Zuge ihrer Reorganisation ihr milliardenschweres Beschaffungswesen konzentrieren, wie die «Handelszeitung» gestützt auf ein internes Dokument berichtet. Konkret gehe es bei dem Projekt darum, dass Migros, Denner, Migrolino und Migros Online ab 2025 Teile ihrer Beschaffung zentralisieren. Dafür wird in der Zentrale im Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) eine gemeinsame «Gruppenbeschaffung» aufgebaut. (bwe)
13:17 Uhr
Donnerstag, 30. Mai
Beschwerde gegen Shopping-App Temu
Die Swiss Retail Federation, der unter anderem Manor, Valora und Volg angehören, hat laut dem «Tages-Anzeiger» beim Staatssekretariat für Wirtschaft eine Beschwerde gegen Temu Schweiz eingereicht. Der Detailhandelsverband wirft der rasant wachsenden chinesischen Onlinehändlerin «unlautere Geschäftspraktiken» vor. Beklagt werden «widerrechtliches Werben mit Prozentrabatten und durchgestrichenen Preisen» und «irreführende Werbung». (bwe)
09:18 Uhr
Donnerstag, 30. Mai
Verdacht auf Geldwäscherei: Finanzdepartement büsst UBS
Die UBS hat Millionen Dollar für den umstrittenen Ex-Präsidenten Jemens, Ali Abdullah Saleh, verwaltet. Dabei gab es intern Tausende Warnhinweise wegen möglicher Geldwäscherei. Doch die Bank unterliess es, die Verdachtsmeldungen auf Geldwäscherei zu melden. Der Bund büsst nun die UBS mit 50'000 Franken. Das meldet Radio SRF, das Einsicht in den Strafbefehl des Finanzdepartements an die UBS erhielt. Im Strafbescheid gehe es um eine Zahlung über 10 Millionen US-Dollar im Jahr 2009 für Saleh – vom Sultan von Oman. Den Check übergab Salehs Sohn der UBS in Zürich. Saleh verteilte dann die Hälfte der Millionen auf verschiedene UBS-Konti, eingetragen auf Familienangehörige.
Offenbar war man sich bei der UBS der Brisanz bewusst: 2011, während den Unruhen des arabischen Frühlings sammelten sich bei der bankinternen Überprüfung von Saleh die erwähnten 5438 Warnhinweise an. Die UBS saldierte daraufhin fast alle Konti der Saleh-Familie. Sie unterliess es aber, die zuständigen Behörden des Bunds zu informieren.
Laut Strafbescheid des EFD habe die Bank nicht nachvollziehbar dokumentiert, warum sie dies nicht tat. Umso mehr als im Fall eines Verdachts auf Geldwäscherei die UBS die Kundenbeziehungen gar nicht hätte abbrechen dürfen – damit Behörden die Gelder beschlagnahmen könnten. Im Vorliegenden Fall hätten sehr hohe Beträge dem staatlichen Zugriff entzogen werden konnten, schreibt das EFD. Das Verschulden der UBS AG ist erheblich. ( sbü. )
08:37 Uhr
DONNERSTAG, 30. MAI
Letzter CS-CEO Ulrich Körner verlässt die UBS
Ulrich Körner, der letzte CEO der Credit Suisse, verlässt die UBS. Er werde Ende Juni nach der Fusion von UBS AG und CS aus der Konzernleitung ausscheiden und die UBS «im späteren Jahresverlauf verlassen», heisst es in der Medienmitteilung. Körner war im August 2022 als CEO der CS angetreten. Nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wurde er Konzernleitungsmitglied der UBS.
Die UBS gab eine Reihe weiterer Änderungen im Topmanagement bekannt. Unter anderem wechselt Iqbal Khan, bisher oberster Vermögensverwalter der UBS, per 1. September nach Asien. Er wird Präsident der Region Asien-Pazifik sowie zusätzlich Co-Präsident für «Global Wealth Management». (mjb)
08:17 Uhr
Donnerstag, 30. Mai
Sunrise erhöht die Internetgeschwindigkeit
Wer sein Internet für zuhause beim Anbieter Sunrise einkauft, kann bald schneller surfen: Die Angebote mit einer Downloadgeschwindigkeit von 1 Gbit/s werden per August auf eine Geschwindigkeit von 2,5 Gbit/s erhöht. Dies erfolgt ohne Mehrkosten. Möglich wird die Erhöhung, weil Sunrise Dienste im Kabelnetz, dem sogenannten HFC-Netz, neu angeordnet hat und auf den Kabelnetz-Standard Docsis 3.1. setzt, wie Sunrise-Chef André Krause am Mittwoch sagte. Das HFC-Netz gehörte früher der Konkurrentin UPC, deren Muttergesellschaft Liberty Sunrise Ende 2020 übernommen hatte.
Laut Krause erreicht Sunrise damit von allen Anbietern die meisten Menschen mit schnellem Internet. Dies sei möglich dank der Kombination des eigenen HFC-Netzes und dem Zugriff auf Glasfasernetze, in die sich Sunrise einmietet. Damit könnten 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Gbit/s versorgt werden. Die Konkurrenten Salt und Swisscom hingegen könnten diese Geschwindigkeit nur jenen 46 Prozent der Bevölkerung bieten, die an ein Glasfasernetz angeschlossen sind. Salt setzt exklusiv auf Glasfasernetze. Swisscom verfügt daneben über ein eigenes Kupfernetz, das aber keine so hohen Geschwindigkeiten ermöglicht.
Laut Sunrise werden 165'000 Kundinnen und Kunden vom Angebot profitieren, ohne etwas weiteres zu unternehmen – davon 50'000, die Sunrise-Produkte über Glasfasernetze nutzen und 115'000, die die Produkte über das HFC-Netz beziehen. Weitere 90'000 Kundinnen und Kunden könnten ebenfalls schneller surfen, wenn sie den Router auswechseln. Ein neues Gerät wird von Sunrise zum einmaligen Preis von 49 Franken angeboten.
Laut Krause könnte die Geschwindigkeit im HFC-Netz theoretisch weiter erhöht werden, dafür wären aber umfangreiche Investitionen nötig, über die Sunrise noch nicht entschieden habe. In Glasfasernetzen sind heute schon Download-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s möglich, die von Sunrise und Co. auch mit eigenen Produkten angeboten werden. (ehs)
09:35 Uhr
Mittwoch, 29. Mai
Dank hoher Renditen: Pensionskassen bauen Leistungen aus
Der langjährige Leistungsabbau in der beruflichen Vorsorge wurde gestoppt. Zu diesem Schluss kommt die neuste Pensionskassen-Studie der Swisscanto, welche die ZKB am Mittwoch publiziert hat. Nach dem guten Börsenjahr 2023 sei die finanzielle Situation der Pensionskassen solid. Im Schnitt erzielten diese eine Nettorendite von 5,1 Prozent. Dadurch konnten die Vorsorgewerke ihr finanzielles Polster deutlich ausbauen. So stieg der Deckungsgrad der privatrechtlichen Kassen von 110,1 auf 113,5 Prozent.
Angesichts der finanziellen Lage stellen die Pensionskassen erstmals wieder bessere Leistungen in Aussicht. Allerdings setzen knapp zwei Drittel der befragten Vorsorgewerke auf Einmalzahlungen. Nur eine Minderheit gewährt höhere Renten. Kaum ein Thema ist die Anhebung des Umwandlungssatzes. (rwa)
07:20 Uhr
Mittwoch, 29. Mai
Axpo erzielt Milliardengewinn
Der Energieversorger ist gut ins Jahr gestartet. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024 hat die Axpo einen Gewinn von 1,2 Milliarden Franken erzielt. In der Vorjahresperiode hatte es allerdings noch 3,2 Milliarden Franken betragen. «In einem sich weiter normalisierenden Marktumfeld setzt Axpo ihre Strategie erfolgreich fort und ist operativ gut unterwegs», teilte der Konzern am Mittwoch mit.
Die Gesamtleistung der Axpo lag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bei 4,2 Milliarden Franken und damit um einen Drittel tiefer als in der Vorjahresperiode. Der Rückgang sei vor allem auf deutlich tieferen Preise für Strom und Gas zurückzuführen, heisst es weiter. (rwa)
05:02 Uhr
Mittwoch, 29. Mai
Insider: Nur noch etwas mehr als 600 Poststellen bleiben übrig
Bei der Post kommt nicht nur die A-Post auf den Prüfstand, sondern – schon kurzfristig – auch das Poststellennetz. Die Konzernleitung will weitere 150 Poststellen schliessen, wie aus deren Umfeld verlautet. Gemäss zuverlässigen Informationen von CH Media sollen noch gut 600 Filialen übrig bleiben. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren waren es noch mehr als 3000 Poststellen. Die Frequenzen an den Schaltern nahmen zuletzt erneut deutlich ab, die Verluste des Poststellenbereichs zu. Über den Abbau informiert die Post noch diesen Mittwoch. Entlassungen sind gemäss Insidern nicht geplant. (pmü)
16:47 Uhr
Montag, 27. Mai
Lufthansa macht Tests mit Gratis-Kaffee an Bord – Swiss wartet ab
An Bord einiger Lufthansa-Jets soll es ab diesem Sommer auch in der Economy-Klasse wieder kostenlose Getränke geben. Lufthansa hatte den kostenfreien Service in der Economy-Klasse im Sommer 2021 beendet und durch Bezahlangebote ersetzt. Ohne Zahlung gab es fortan für die Passagiere nur noch eine Flasche Wasser und ein Stück Schokolade. Rund drei Jahre nach Abschaffung des Gratis-Service sollen nun testweise und auf einzelnen Kurz- und Mittelstrecken ausgewählte Getränke wie Tee und Kaffee wieder kostenlos ausgeschenkt werden, teilte die Airline gestern mit. Im Rahmen der Kundenzufriedenheitsanalysen sollen die Reaktionen erfasst werden.
Die Swiss, die zum Lufthansa-Konzern gehört, beteiligt sich hingegen «aktuell» nicht an solchen Testläufen mit Gratis-Getränken, wie sie auf Anfrage festhält. «Wir stehen jedoch im engen Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen bei der Lufthansa und sind gespannt auf die Resultate», sagt Sprecherin Karin Montani. «Basierend darauf werden wir entsprechende Schlüsse für Swiss ziehen.» (dpa/fv)
16:45 Uhr
Montag, 27. Mai
Gemischte Gefühle gegenüber künstlicher Intelligenz
Sie hält immer mehr Einzug in die Arbeitswelt: die künstliche Intelligenz (KI). Das steigert in vielen Bereichen die Effizienz und Produktivität. Solche und weitere Vorteile hat die Schweizer Bevölkerung erkannt, wie aus dem neuesten Digitalbarometer 2024 der Mobiliar-Versicherung und der Stiftung Risiko-Dialog hervorgeht. Die Mehrheit der Bevölkerung sehe die Nutzung von KI in verschiedenen Arbeitsfeldern positiv, heisst es in der Untersuchung, für die knapp 2000 Personen online befragt wurden.
Doch je nach Branche fällt das Resultat sehr unterschiedlich aus. Grosse Chancen erkennen die Befragten etwa im Energiesektor: 80 Prozent beurteilen den KI-Einsatz hier positiv. Denn damit kann etwa der Netzbetrieb oder die Energiespeicherung effizienter gestaltet werden, wie kürzlich eine Studie des Beratungsunternehmens PWC zeigte. Auch zur Versorgungssicherheit kann KI beitragen, indem sie etwa die Erträge aus erneuerbaren Quellen oder drohende Ausfälle genauer vorhersagt.
Mehr Vorteile als Nachteile sehen die Befragten auch in den Bereichen Verkehr und Logistik (72 Prozent), Gesundheitswesen (60 Prozent) und Bildung (56 Prozent). Skeptisch ist dagegen eine Mehrheit beim KI-Einsatz in der Regierung und Verwaltung. «Nur» für 38 Prozent dominieren die Vorteile, für 57 Prozent überwiegen die Nachteile, 5 Prozent sind neutral eingestellt. Gleich negativ fällt das Verdikt beim E-Commerce aus.
Bei Medien und Unterhaltung sehen gar 63 Prozent den KI-Einsatz als eher oder sehr problematisch. Die Autorinnen und Autoren des Digitalbarometers führen das Misstrauen zum einen auf eine Sorge vor Desinformation zurück. Es werde als Risiko wahrgenommen, dass KI zur Verbreitung von manipulierten oder falschen Informationen verwendet werden könne. Zum anderen sähen viele Befragte eine Gefahr in der zunehmenden Automatisierung unterschiedlicher Aufgaben, etwa der Inhaltsgenerierung.
Zusammenfassend nähmen die Befragten Chancen vor allem in ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten wahr. Besorgt zeigten sie sich insbesondere «da, wo KI einen potenziell grossen Einfluss auf soziale und gesellschaftliche Gefüge» habe. (aka)
14:27 Uhr
Montag, 27. Mai
Öffentlicher Verkehr weniger pünktlich
Jedes Jahr erheben Testkundinnen und Testkunden für das Bundesamt für Verkehr (BAV) die Qualität im öffentlichen Regionalverkehr. Dazu zählen beispielsweise Busverbindungen auf dem Land und in Agglomerationen oder S-Bahnen. Diese werden vom Bund mitfinanziert. Nicht zum Regionalen Personenverkehr gehören der Fernverkehr und der öffentliche Verkehr in Städten, also beispielsweise Busse und Trams in Zürich, Basel oder Bern.
Im Jahr 2023 war die Qualität im regionalen Bus- und Zugverkehr hoch, teilt das BAV am Montag mit. Insbesondere bei der Sauberkeit und der Kundeninformation seien im vergangenen Jahr weitere Fortschritte erzielt worden. Bei der Sauberkeit an Haltestellen, die in den vergangenen Jahren am schlechtesten bewertet wurde, konnten die Verkehrsbetriebe die grössten Fortschritte erzielen, auch wenn sie insgesamt weiterhin den grössten Negativpunkt darstellt.
In Sachen Pünktlichkeit zeigte die Entwicklung im Jahr 2023 nach unten: 94,5 Prozent der Regionalzüge erreichten ihr Ziel pünktlich. Im Jahr zuvor waren es noch 95 Prozent gewesen. Im Busverkehr sank die Pünktlichkeit gar auf unter 90 Prozent. (ehs)
16:46 Uhr
Freitag, 24. Mai
182 Entlassungen: Vetropack-Angestellte protestieren
Der Aufschrei war gross, als der Flaschen- und Glasverpackungshersteller Vetropack vor zehn Tagen ankündigte, das Werk im waadtländischen Saint-Prex zu schliessen. Es ist das Ende der letzten Glasflaschenfabrik in der Schweiz, 182 Angestellte verlieren deshalb ihren Job. In den kommenden Tagen sollen die ersten Kündigungen verschickt werden, wie Vetropack nun bekannt gibt. Bis Ende August soll die Schliessung vollzogen sein.
Dagegen formiert sich Widerstand: Bereits am Freitag legten die Angestellten ihre Arbeit nieder, unterstützt von den Gewerkschaften Unia und Syna. Vor der Unterzeichnung eines Sozialplans dürften keine Entlassungen ausgesprochen werden. Man werde die Arbeit erst wieder aufnehmen, wenn dies erfüllt sei. (aka)
15:53 Uhr
Freitag, 24. Mai
Zweiter Anlauf für Präsidentin der Migros-Delegierten
Es war eine Überraschung: Im März wurde Marianne Meyer, die Präsidentin der Migros-Delegiertenversammlung, nicht wiedergewählt. Die Delegierten entschieden daraufhin, die Wahl zu verschieben. So kommt es nun am 15. Juni an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung zum Showdown.
Wie die Migros am Freitag in einer Mitteilung schreibt, stellen sich vier Kandidierende für das Präsidium des obersten Gremiums zur Verfügung – darunter auch die seit 2020 amtierende Präsidentin Marianne Meyer, die einen zweiten Anlauf nimmt. Die weiteren Anwärterinnen und Anwärter sind Séghira Egli, Dominique Imhof und Edith Spillmann. Damit eine Wahl gültig ist, müssen drei Viertel der Delegierten anwesend sein und die gewählte Person muss das absolute Mehr erreichen. (aka)
11:59 Uhr
Freitag, 24. Mai
Ex-LUKB-Chef übernimmt Präsidium bei der Migros Bank
Bernhard Kobler wird neuer Verwaltungsratspräsident der Migros Bank. Das hat die Generalversammlung am Donnerstag beschlossen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der 66-jährige Kobler sitzt seit über sieben Jahren im Verwaltungsrat. In seiner neuen Funktion folgt er auf den ehemaligen Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen, der nach seinem Rücktritt nun auch aus dem Bankgremium ausscheidet. Neu mit dabei ist der aktuelle Migros-Lenker Mario Irminger. Er wurde zum Vizepräsidenten gewählt.
Kobler blicke «auf eine langjährige CEO-Erfahrung und Karriere in der Finanzindustrie» zurück, heisst es weiter. Diese wurde jedoch auch von Turbulenzen überschattet. Nach zehn Jahren an der Spitze der Luzerner Kantonalbank (LUKB) musste Kobler 2014 wegen einer später zurückgezogenen Strafklage zurücktreten. Es folgte ein kurzes Intermezzo bei der Privatbank Julius Bär, daraufhin übernahm er verschiedene Mandate, etwa in Stiftungen. (aka)
10:55 Uhr
Freitag, 24. Mai
Freie Bahn für neue Krypto-Fonds
Die Zulassung von Bitcoin-ETFs Anfang des Jahres hat eine Kurs-Rally der Kryptowährung ausgelöst. Nun stellt die US-Börsenaufsicht SEC auch für die zweitwichtigste Digitalwährung Ether die Ampel auf Grün. Sie erlaubte am Donnerstag unter anderem der Technologiebörse Nasdaq und der New York Stock Exchange den Handel mit Finanzprodukten, die auf der Ethereum-Datenbank (Blockchain) basieren.
Um solche Fonds aufzusetzen, benötigen interessierte Anbieter wie die Investmentgesellschaften Blackrock und Fidelity allerdings noch eine individuelle Zulassung der Behörde, wie aus einer SEC-Mitteilung hervorgeht. Dafür wurde zunächst keine Frist festgesetzt. Für das bekannteste Digitalgeld Bitcoin sind sie bereits seit Januar zugelassen.
Schon die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs wurde als wichtiger Meilenstein gesehen, um Digitalwährungen stärker für traditionelle Investoren zu öffnen. In solche Fonds statt direkt in Kryptogeld zu investieren, ist für viele Anleger eine geringere Hürde. (dpa)
10:12 Uhr
Freitag, 24. Mai
Stellenmeldepflicht: Massiv weniger Meldungen wegen tiefer Arbeitslosigkeit
Im vergangenen Jahr sind dem Bund massiv weniger offene Stellen gemeldet worden. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilt, sind vergangenes Jahr den Behörden noch 287’671 offene Stellen vorzeitig gemeldet worden. Zum Vergleich: 2022 war die Zahl der im Voraus gemeldeten offenen Stellen mit 476’597 noch fast doppelt so hoch.
Der Bund führt diesen massiven Rückgang bei der Anzahl gemeldeter offener Stellen auf die rekordtiefe Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr zurück. Diese habe zudem auch zu weniger meldepflichtigen Berufsarten geführt.
Das alles kommt denn auch nicht ganz unerwartet: Bereits Anfang Jahr, zehn Jahre nach der Einführung der Pflicht zur Meldung offener Jobs an die Behörden, war die Frage aufgekommen, ob die Bevorzugung arbeitsloser Arbeitskräfte überhaupt noch wirke. Erst recht nahm die Debatte Fahrt auf, als kurz darauf bekannt wurde, dass auch die Zahl der im vergangenen Jahr zugewanderten Personen 2023 massiv anstieg – nämlich um 17’506 auf 98’851 Menschen .
In seinem 5. Monitoringbericht kommt das Seco nun zumindest zum Schluss, dass die Behörden die seit zehn Jahren gesetzlich verankerte Stellenmeldepflicht wie in den Jahren zuvor auch 2023 «gesetzeskonform und effizient umgesetzt» haben. Das gilt demnach insbesondere auch für die Kantone Luzern und St.Gallen, welche das Seco diesmal besonders genau unter die Lupe nahm, wie es weiter heisst.
Dass das Thema Zuwanderung und Behandlung von In- und Ausländern auf dem Arbeitsmarkt politisch nicht vom Tisch ist, beweist eine weitere Volksinitiative. So hat die SVP bereits eine nächste Zuwanderungsinitiative am Start. Noch bis Anfang 2025 hat sie Zeit, die für das Zustandekommen nötigen 100’000 gültigen Unterschriften für ihr Vorhaben mit dem Titel «Keine 10-Millionen-Schweiz» zusammen zu bringen. (sat)
07:35 Uhr
Freitag, 24. Mai
Mehr Kunden und Gewinn: Salt Mobile wächst weiter
Der drittgrösste Telekomanbieter der Schweiz bleibt auf Wachstumskurs. Wie Salt am Freitag mitteilt, ist die Zahl seiner Mobilfunk-Abos im ersten Quartal um 30’200 auf insgesamt gut 1,6 Millionen Abos gestiegen. Auf ein gutes Echo bei Privatkunden stosse insbesondere das seit Anfang Jahr angebotene neue Post-Mobile-Angebot.
Finanziell konnte Salt den Betriebsertrag in den ersten drei Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,4 Prozent auf 235,8 Millionen Franken steigern. Nebst Einnahmen aus zusätzlichen Abos hätten auch seit Herbst durchgeführte Preiserhöhungen zu diesem Plus geführt. Salt begründete diese mit der Teuerung.
Auch unter dem Strich konnte Salt sein Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) steigern – und zwar innert Jahresfrist um 4,3 Prozent auf 140,8 Millionen. Laut dem Unternehmen kam dieses «starke finanzielle Ergebnis» trotz anhaltend dynamischem Umfeld zustande.
Salt gehört seit 2015 der Gesellschaft NJJ Capital des französischen Telekom-Unternehmers Xavier Niel. Seit vergangenem Jahr steht Max Nunziata an der Spitze des Schweizer Telekom-Anbieters. (sat)
07:12 Uhr
Freitag, 24. Mai
Fahrplan steht: So soll das Papiergeschäft von CPH abgetrennt werden
Dass das börsenkotierte Chemie- und Papier-Unternehmen CPH sein Papier-Geschäft abspalten will, ist seit März bekannt. Am Freitag nun hat der Verwaltungsrat auch noch die Details zur Abspaltung und Gründung des neuen, unabhängigen Unternehmens bekannt gegeben, in welchem das abgespaltene Geschäft weiterbetrieben werden soll.
Wie die Luzerner Industriegruppe mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung (GV) vom 20. Juni schreibt, soll jeder bestehende CPH-Aktionär pro Namenaktie eine Namenaktie der neuen Perlen Industrieholding AG erhalten. Folgt die GV dem Entscheid des Verwaltungsrats, sollen die Aktien dieser neuen Firma bereits ab dem 25. Juni ausserbörslich gehandelt werden können. (sat)
16:41 Uhr
Donnerstag, 23. Mai
CKW-Chef und Axpo-Mann Martin Schwab ist neuer VSE-Präsident
Die mächtige Stromorganisation, der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), hat einen neuen Präsidenten: Die Delegierten haben am Donnerstag an ihrer Generalversammlung in Lugano Martin Schwab ihre Stimme gegeben. CKW-Chef und Axpo-Geschäftsleitungsmitglied Schwab folgt auf den Alpiq-Manager Michael Wider, der in den Ruhestand tritt und damit nicht mehr zur Wiederwahl antrat.
Zudem wurden Alpiq-CEO Antje Kanngiesser und David Maurer, der Geschäftsführer Energie- und Wasserversorgung Oberburg, neu in den VSE-Vorstand gewählt. Von der Generalversammlung für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt wurden zudem Michael Beer (BKW, Regiogrid), Patrick Bertschy (Romande Energie, Regiogrid), Martin Pflugshaupt (Energie Gossau, DSV) und Claus Schmidt (IWB, Swisspower). (fv)
14:13 Uhr
Donnerstag, 23. Mai
Weniger Umsatz, aber stabile Marge für Artemis-Gruppe
Die Artemis-Gruppe, zu der etwa das Küchenbauunternehmen Franke und der Präzisionstechnologiekonzern Feintool gehören, blickt auf ein «herausforderndes Jahr» zurück. Der Nettoumsatz sank 2023 um 3,1 Prozent auf 3,49 Milliarden Franken, vor allem wegen negativer Währungseffekte, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Dafür konnte die Artemis die Nettoverschuldung verringern sowie den Cashflow und die Eigenkapitalquote erhöhen. Stabil blieb mit 6,4 Prozent die operative Marge.
Die Geschäftsleitung beurteilt die Leistung angesichts des schwierigen Umfeldes, das auch im 2024 «volatil» bleibe, als «solide». Zudem habe die Gruppe, die per Ende Jahr rund 11'300 Mitarbeitende beschäftigte, ihre Wettbewerbssituation verbessern können. (aka)
11:26 Uhr
Donnerstag, 23. Mai
Wie Migros: Emmi verzichtet auf Nutri-Score
Diese Woche gab die Migros bekannt, künftig auf die Nährwert-Kennzeichnung Nutri-Score zu verzichten ( CH Media berichtete ). Erst vor drei Jahren hatte die Detailhändlerin diese freiwillig eingeführt, Tausende von Produkten damit ausgestattet und dafür geworben. Der Nutri-Score zeigt auf einer Farbskala von A bis E, wie ausgewogen ein Produkt zusammengesetzt ist. Er soll der Kundschaft eine Orientierung beim Einkauf von Lebensmitteln bieten. Die Stiftung für Konsumentenschutz kritisierte diesen Schritt der Migros scharf.
Doch nun tut es Emmi der Migros gleich. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet , verabschiedet sich auch der Luzerner Milchverarbeiter vom ursprünglich aus Frankreich kommenden Vergleichssystem. Man habe sich entschieden, «bei Neuheiten auf den Nutri-Score zu verzichten», lässt Emmi gegenüber der Zeitung verlauten. Demnach werden nur «Caffè Latte»-Getränke vorerst weiterhin das Label auf der Packung verwenden.
Nestlé, der grösste Nahrungsmittelhersteller der Welt, hält hingegen am Label fest, wie der Konzern gegenüber dem «Tagi» sagt: «Wir möchten, dass der Nutri-Score in den Regalen noch präsenter wird, damit die Konsumentinnen und Konsumenten Produkte innerhalb einer Kategorie vergleichen und eine bewusste Wahl treffen können.» Coop verzichtete derweil von Anfang an auf den Nutri-Score. ( bwe )
11:05 Uhr
Donnerstag, 23. Mai
Börsenstar Nvidia mit neuem Rekord und Aktiensplit
Das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia wächst explosiv. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz von 7,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 26 Milliarden Dollar - ein Zuwachs von 262 Prozent. Und die Nachfrage bleibt stark: Bei Nvidias neuen Chipsystemen zeichnen sich Engpässe bis ins kommende Jahr hinein ab.
Nvidia-Technologien wurden ursprünglich für Grafikkarten entwickelt. Dann stellte sich aber heraus, dass sie sich auch hervorragend für die Rechenarbeit beim Anlernen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) eignen. Nvidias Chips wurden damit zu einer Schlüsseltechnologie für die KI-Zukunft - und der Konzern profitiert zusätzlich vom Geschäft mit dazugehöriger Software und Diensten.
Inzwischen komme Nvidia-Technik nicht mehr nur beim Training, sondern auch beim Betrieb von KI-Anwendungen zum Einsatz, betonte Konzernchef Jensen Huang. Darin steckt potenziell ein noch stabileres Geschäft. Denn das Anlernen braucht zwar eine gewaltige Rechenleistung – ist jedoch nur einmal pro KI-Modell nötig. Huang geht zugleich davon aus, dass KI künftig alle möglichen Inhalte generieren wird, die heute aus Datenbanken abgerufen werden.
Nvidia wolle nun jedes Jahr eine neue Generation seiner Chips vorstellen, sagte Huang. Im März hatte er das Chipsystem «Blackwell» vorgestellt. Es wird derzeit produziert und in den kommenden Monaten sollen erste Geräte an die Kunden gehen. «Blackwell» ist viel leistungsstärker als die vorherige Generation «Hopper» - und nicht nur Tech-Riesen wie der Facebook-Konzern Meta und Amazons Cloud-Sparte AWS stehen auf der Kundenliste.
Besonders stark wuchs im vergangenen Quartal das Geschäft mit Technik für Rechenzentren. Mit 22,6 Milliarden Dollar war der Umsatz mehr als fünfmal höher als vor einem Jahr, wie Nvidia nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Selbst binnen drei Monaten war es noch ein Plus von 23 Prozent. Huang sprach in einer Telefonkonferenz mit Analysten von einer «neuen Industriellen Revolution». Im Kommen sei ein neuer Typ von Rechenzentren: «KI-Fabriken».
Für das laufende Quartal stellte der Konzern einen weiteren Umsatzanstieg auf 28 Milliarden Dollar in Aussicht - während Analysten im Schnitt eine Prognose von knapp 27 Milliarden Dollar erwartet hatten.
Der Quartalsgewinn von Nvidia sprang im Jahresvergleich von gut 2 auf knapp 14,9 Milliarden Dollar hoch. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch um gut sechs Prozent zu und überschritt dabei erstmals die Marke von 1000 Dollar. Nvidia gab auch eine Anhebung der Dividende und einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 bekannt. (dpa)
08:13 Uhr
Donnerstag, 23. Mai
Masken-Millionäre setzten VBS unter Druck
Sie waren zwei der ganz grossen Profiteure der Pandemie: Die beiden Jungunternehmer Jascha Rudolphi und Luca Steffen mit Ihrer Maskenfirma Emix Trading. Sie verkauften dem Bund nicht nur Schutzmasken von teils zweifelhafter Qualität für Millionenbeträge. Wie der «Tages-Anzeiger» und «SRF» nun berichten, setzten im Frühjahr 2020 die Einkäufer im Verteidigungsdepartement VBS auch massiv unter Druck.
Der erste Kontakt zwischen den Jungunternehmern und dem Bund erfolgte am 27. Februar 2020, zwei Tage nach dem ersten Corona-Fall in der Schweiz. Der Bund stand unter Druck, sich mit Masken für den Ernstfall einzudecken. Das VBS fragte bei Emix nach den genauen Spezifikationen der angebotenen Ware. Ein Emix-Mitarbeiter antwortete: «Gut, dass sie sich so rasch melden. Wir haben unzählige Anfragen aus dem DACH-Raum – habe gestern alleine mit 5 Spitälern den ganzen Bestand verkauft. Viele blieben unbedient. (...) Sie finden das Angebot im Anhang.»
Bei diesem subtilen Hinweis blieb es nicht. Emix bot Masken der US-Marke 3M an. Zwei Millionen Stück für je 8.90 Euro. «Wir haben die 2 Millionen Stück Ende nächste Woche in der Schweiz – wir brauchen noch heute die Zusage, da wir sonst den anderen Kunden zusagen werden», schrieb der Emix-Verkäufer. Am Mittag hiess es dann seitens Emix: «Wir haben soeben eine verbindliche Bestellung vom deutschen Staat für die volle Menge von 2 Millionen Stück erhalten. Wir haben den Bestand noch bis 14.00 für Sie reserviert, danach müssen wir eine Entscheidung treffen.» Um 14.01 schlug der Bund zu.
Tatsächlich lieferte Emix dann nicht Masken der renommierten Marke 3M, sondern Ware aus China. Fraglich ist zudem, ob es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eine Bestellung des deutschen Staats gegeben hatte - oder ob Emix geblufft hatte, um den Druck auf das VBS zu erhöhen. Das deutsche Bundesgesundheitsministerium bestellte nämlich erst am 12. März 2020 Masken bei Emix.
Gegen die Masken-Millionäre läuft bei der Staatsanwaltschaft Zürich derzeit ein Verfahren wegen Verdachts auf Wucher. Es gilt die Unschuldsvermutung. (mpa)
17:16 Uhr
Mittwoch, 22. Mai
Nestlé reagiert auf Fettweg-Spritzen-Boom
Abnehmspritzen wie Wegovy sind zunehmend gefragt. Mit den neuartigen Appetitzüglern stellt sich die Frage, welche Folgen dies für Nahrungsmittelhersteller hat, die ihr Geld unter anderem mit fettigen und süssen Produkten verdienen. Manche Branchenanalysten haben grosse Umsatzeinbussen vorhergesagt.
Nun reagiert Nestlé: Der Westschweizer Nahrungsmittelriese lanciert in den USA eine neue Linie namens «Vital Pursuit». Deren Produkte sind speziell auf Kunden ausgerichtet, die GLP-1-Medikamente verwenden, also Fettweg-Spritzen. Die Mahlzeiten haben einen hohen Gehalt an Proteinen, Ballaststoffen und anderen Nährstoffen. Eine Lancierung in der Schweiz und anderen Märkten ausserhalb der USA ist derzeit nicht geplant, wie eine Sprecherin auf Anfrage von CH Media sagt. (bwe)
16:03 Uhr
Mittwoch, 22. Mai
Filmstudio Pixar entlässt 175 Angestellte
Filme des Disney-Pixar-Studios wie «Toy Story», «Up» oder «Finding Nemo» warten üblicherweise mit einem Happy-end auf. Doch für 14 Prozent des Personals endete der Dienstag mit dem blauen Brief. 175 Angestellte werden entlassen, wie US-Medien berichten.
Im Vorfeld war gar über einen Personalabbau von 20 Prozent spekuliert worden. Und bereits im Sommer letzten Jahres wurden 175 Stellen gestrichen.
Das renommierte, erfolgsverwöhnte Animationsstudio mit Sitz in Emeryville in der Nähe von San Francisco kämpft mit den neuen Publikumsgewohnheiten, die sich nach der Pandemie etabliert haben, und die von Disney-Pixar selbst gefördert wurden. Während der Krise lancierte das Studio Filme wie «Soul» oder «Luca» direkt auf seinem Streamingkanal Disney+. Die Kundschaft gewöhnte sich ans Kinoerlebnis zu Hause – mit der Folge, das spätere Kinostarts wie «Lightyear» floppten. Die unmittelbaren Hoffnungen liegen nun auf der Fortsetzung «Inside Out 2», die im Sommer in die Kinos kommt. (bwe)
11:04 Uhr
Mittwoch, 22. Mai
Swiss stellt den Verwaltungsrat neu auf
Aus fünf werden es drei: Die Fluggesellschaft Swiss verpasst ihrem eigenen Verwaltungsrat eine Schrumpfkur. Künftig handelt es sich nur noch um eine Dreier-Aufsichtsgremium. Per 1. Juli scheiden André Blattmann, Ex-Chef der Schweizer Armee, und Aswhin Bhat, Chef des Lufthansa-Cargo-Geschäfts, aus dem Swiss-Verwaltungsrat aus. Sie werden nicht ersetzt, im Gegensatz zum ebenfalls abtretenden Remco Steenbergen. Für ihn rückt Noch-Swiss-CEO Dieter Vranckx nach, der künftig als Vizepräsident amtet nebst seiner Haupttätigkeit im Lufthansa-Vorstand.
Präsidiert wird das Gremium nach wie vor von Reto Francioni. Ergänzt wird es nebst Vranckx durch Doris Russi Schurter. Unklar ist derweil weiterhin wer die Nachfolge von Vranckx als Airline-Chef antreten wird. Ein Entscheid dazu wird in der Branche noch im Mai erwartet.
Zum Austritt von André Blattmann sagt Francioni, der Ex-Armee-Chef habe massgeblich dazu beigetragen, die Swiss durch eine der schwierigsten Krisen ihrer Geschichte zu manövrieren. «Seine Unterstützung, auch und gerade im Austausch mit den Bundesbehörden, war für die Swiss von höchstem Wert.» Zudem habe er die Schweizer Werte und die Swissness stets in den Fokus gerückt. Lufthansa-Manager Bhat lobt Franconi für seine profunden Kenntnisse im Frachtbereich.
Mit der Verkleinerung des Verwaltungsrats dürften sich Kritikerinnen und Kritiker bestätigt fühlen, dass bei wichtigen Themen vermehrt die Lufthansa das Sagen hat bei der Schweizer Tochtergesellschaft. (bwe)
08:23 Uhr
Mittwoch, 22. Mai
Weniger Aufträge und Exporte: Lage der MEM-Industrie weiterhin schwierig
Die Geschäftslage der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie bleibt eine Herausforderung. Im ersten Quartal waren die wichtigsten Kennzahlen rückläufig. So exportierten die Branchen weniger Güter (-8,5 Prozent). Auch die Auftragseingänge sanken gegenüber der Vorjahresperiode um 2,3 Prozent. Eine Abnahme um 5,4 Prozent resultierte auch bei den Umsätzen.
Trotzdem sieht Swissmem, der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, Licht am Ende des Tunnels. «Die Anzeichen verdichten sich aber, dass die Talsohle des Abschwungs dieses Jahr erreicht wird», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Risiken bestünden weiterhin in den geopolitischen Unsicherheiten sowie im zunehmenden Protektionismus, der die Dynamik der Weltwirtschaft beeinträchtige. Swissmem fordert deshalb bessere Rahmenbedingungen – wie eine sichere und wettbewerbsfähige Stromversorgung, weshalb sich der Verband auch für das Stromgesetz ausspricht, das am 9. Juni an die Urne kommt. (rwa)
14:49 Uhr
Dienstag, 21. Mai
ÖV-Branche bleibt bei E-Tickets hart
Die Praxis sorgte für Ärger: Wer bisher sein digitales Billett einige Sekunden zu spät löste, musste eine Busse zahlen. Denn in den entsprechenden Branchenbestimmungen heisst es, dass bei der Abfahrt des Zuges ein gültiges Ticket vorliegen muss. Diese Vorgehensweise rügte das Bundesamt für Verkehr (BAV) – mit bescheidenem Erfolg, wie sich jetzt zeigt. Denn im gestern publizierten Ergebnis einer Arbeitsgruppe heisst es weiterhin, dass der Billettkauf vor der tatsächlichen Abfahrt vollständig abgeschlossen sein muss. Dies, weil es eine schweizweit einheitliche Regelung brauche. Und: Der finanzielle Schaden ist zu gross, als dass die Branche eine lockere Regelung gewähren könnte. Die Ausfälle wegen Betrügern beliefen sich letztes Jahr auf rund 200 Millionen Franken. «Dies ist unfair gegenüber den Fahrgästen, welche die Fahrausweise bezahlen. Zudem müssen die fehlenden Einnahmen durch die Gemeinden, Städte, Kantone und den Bund getragen werden.» Trotz harter Linie ortet die Branche selbst Verbesserungsbedarf. So möchte sie die App verbessern. Zudem sind eine Informationskampagne, ein verbesserter Austausch in der Branche sowie eine Erfolgskrontrolle durch das BAV geplant. (mpa)
09:03 Uhr
Dienstag, 21. Mai
Italien erlaubt Swisscom die Vodafone-Übernahme
Die Swisscom will den italienischen Ableger des Telekom-Konzerns Vodafone übernehmen. Wie die Swisscom am Dienstag mitteilt, hat das italienische Ministerratspräsidium die Transaktion «vorbehaltlos genehmigt». Geprüft wurde, ob das Vorhaben wesentliche öffentliche Interessen Italiens gefährden oder beeinträchtigen könnte.
Die Übernahme von Vodafone Italien verläuft gemäss der Mitteilung planmässig, stehe aber unter Vorbehalt weiterer regulatorischer und anderer Genehmigungen und werde voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen. Swisscom will Vodafone Italia für 8 Milliarden Euro übernehmen. Der vor allem im Mobilfunk starke Ableger des britischen Vodafone-Konzerns soll mit der italienischen Swisscom-Tochter Fastweb zusammengelegt werden. Dadurch soll der zweitgrösste Telekom-Anbieter Italiens mit einem kombinierten Umsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro entstehen. (ehs)
07:45 Uhr
Dienstag, 21. Mai
Idorsia: Jean-Paul Clozel tritt als Chef zurück
Beim Basler Pharmaunternehmen Idorsia kommt es zu mehreren Wechseln auf der Teppichetage: Unternehmensgründer Jean-Paul Clozel, 69, tritt als Chef zurück – und will sich an der Generalversammlung zum Verwaltungsratspräsidenten wählen lassen. Das teilt Idorsia am Dienstag mit. «Für mich ist die Zeit gekommen, mich aus dem Tagesgeschäft von Idorsia zurückzuziehen und die Zügel an eine jüngere Generation zu übergeben, die das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führt», hält Clozel fest.
Künftig soll der derzeitige Finanzchef André Muller die operativen Geschicke des börsenkotierten Unternehmens leiten, das Clozel zusammen mit seiner Frau, der Idorsia-Forschungschefin Martine Clozel, aus der früheren klinischen Pipeline von Actelion gegründet hatte. Es ist eine Lösung, die Kontinuität verspricht. Muller und die Clozels arbeiteten schon bei Actelion zusammen. «In den mehr als 10 Jahren meiner Zusammenarbeit mit André habe ich festgestellt, dass er, obwohl er kein ausgebildeter Wissenschaftler ist, ein ausgeprägtes Verständnis für die Entdeckung und Entwicklung innovativer Arzneimittel hat», sagt Clozel. «Ich habe volles Vertrauen, dass er die richtige Person ist, um das Unternehmen auf eine spannende Zukunft vorzubereiten.»
Auch im Idorsia-Verwaltungsrat gibt es mehrere Wechsel: Jörn Aldag, Felix Ehrat und Peter Kellogg stellen sich nicht zur Wiederwahl. Neu soll Bart Filius in das oberste Strategiegremium gewählt werden. Jean-Paul Clozel stellt sich zur Wiederwahl und soll Präsident werden, der amtierende Verwaltungsratspräsident Mathieu Simon übernimmt die Rolle des Vizepräsidenten und Lead Independent Directors. Ebenfalls zur Wiederwahl stellen sich Srishti Gupta, Sophie Kornowski und Sandy Mahatme.
Ebenfalls am Dienstag hat Idorsia seine neusten Zahlen vorgelegt. Demnach weist das Unternehmen für das vergangene Jahr einen Nettoverlust von 298 Millionen Franken aus. (fv)
07:18 Uhr
Dienstag, 21. Mai
Die Versicherten sind grundsätzlich zufrieden mit ihrer Versicherungen _ aber es gibt Unterschiede
Die Versicherten bleiben sind in der Schweiz ihren Versicherungen oft treu, die Wechselquoten jedenfalls relativ tief. Unklar ist aber, ob sie mit ihren Versicherungen auch zufrieden sind. Der Onlinevergleichsdienst Moneyland wollte es genauer wissen und hat in einer «repräsentativen Online-Umfrage» die Zufriedenheit nach verschiedenen Kriterien abgefragt: Freundlichkeit der Mitarbeitenden, Beratung, Kundendienst allgemein, Smartphone-App, Kosten und Prämien, Preis-Leistung und allgemeine Zufriedenheit. Zudem wurde bei den 1500 Teilnehmenden die Gesamtzufriedenheit mit verschiedenen Versicherungen abgefragt: konkret mit Auto-, Haftpflicht-, Hausrat-, Lebens-, Reise-, Rechtsschutz und Cyber-Versicherungen.
Das Fazit der Umfrage: Grundsätzlich sind die Befragten mit ihren Versicherungen zufrieden. Allerdings gibt es «deutliche Unterschiede», wie Moneyland am Dienstag mitteilt. Am zufriedensten seien die Versicherten mit Hausrat- und Haftpflichtversicherungen, am wenigsten mit Lebensversicherungen, hält Moneyland-Chef Benjamin Manz fest.
Positiv bewertet wird die Freundlichkeit der Versicherungs-Mitarbeitenden. Sie kommt auf durchschnittlich 8,1 von 10 Punkten bewertet, der allgemeine Kundendienst auf 7,9 Punkten. Für die Beratung und die allgemeine Zufriedenheit gibt es je 7,8 Punkten. Am schlechtesten schneiden die Kosten und Prämien ab. Hier gibt es im Schnitt nur 7,3 Punkte.
Und es gibt auch regionale Unterschiede: So sind die Westschweizer mit ihren Versicherungen insgesamt unzufriedener als die Deutschschweizer – etwa mit den Kosten.
In der Moneyland-Umfrage beim Kriterium «allgemeinen Zufriedenheit» am besten abgeschnitten hat die Versicherung Smile mit 8,4 von 10 Punkten. Auf den weiteren Podestplätzen folgen die Mobiliar (8,3 Punkte) und TCS (8,2 Punkte). Dann kommen die Versicherungen Vaudoise, Baloise und Allianz, die je 7,8 Punkte erzielten.
Bei den Autoversicherungen schneidet ebenfalls Smile am besten ab (8,4 Punkte), gefolgt von TCS und Zurich mit 8,2 Punkten, Baloise mit 8,1 Punkten sowie Generali und Allianz mit je 8 Punkten. Bei den Reiseversicherungen erreichten die Baloise und der TCS mit je 8,4 von 10 Punkten die höchste Punktzahl. Generali, Mobiliar und Zurich erreichen je 7,9 Punkte, Allianz, Axa und Helvetia je 7,8 Punkte. (fv)
13:29 Uhr
Freitag, 18. Mai
Am Dienstag will die Migros erste Kündigungen aussprechen
Nachdem die Migros am Mittwoch einem neuen, verbesserten Sozialplan zugestimmt hat, stehen bereits die ersten Entlassungen an. Dies im Rahmen der bereits Anfang Jahr angekündigten Absicht, mehrere Unternehmen und Fachmärkte verkaufen zu wollen.
Wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» am Freitag als erstes Medium berichtete, will die Migros am Dienstag nach Pfingsten die ersten 130 Kündigungen aussprechen. Gegenüber der Finanznachrichtenagentur AWP liess sich ein Migros-Sprecher gleichentags mit den Worten zitieren: «Die genannten Zahlen werden in etwa zutreffen.» Dabei wird es laut dem Sprecher in allen Bereichen zu Anpassungen kommen.
Im Februar hatte die Migros angekündigt, nebst Hotelplan, mehreren Industrie-Unternehmen auch Fachmärkte verkaufen zu wollen. Dies im Rahmen einer Fokussierung und Anpassung der Firmenstrategie des Orangen Riesen. (chm)
10:06 Uhr
Freitag, 17. Mai
Hilti büsst wegen Frankenstärke an Umsatz ein
Der Liechtensteiner Baugerätehersteller Hilti hat in den ersten vier Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 2,1 Milliarden Franken erarbeitet. Das sind 1,8 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Als Grund nennt Hilti einen «weiterhin deutlich negativen Währungseffekt» wegen der Frankenstärke. In Lokalwährungen nahmen die Verkäufe um 2,9 Prozent zu.
Laut Hilti hat sich die Bautätigkeit in Europa, wo Hilti gut die Hälfte des Umsatzes generiert, deutlich verlangsamt, während der Markt etwa in Asien oder Lateinamerika noch wachse. Hilti-Chef Jahangir Doongaji sagt, «wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir mit unserer robusten globalen Struktur weiterhin stärker wachsen können als der Markt». Für das ganze Jahr erwartet Hilti in Lokalwährungen eine Umsatzzunahme «im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich». Der Konzern beschäftigt 34’000 Mitarbeitende in 120 Ländern. (T.G.)
09:24 Uhr
Freitag, 17. Mai
Von der FDP zu Swico: Jon Fanzun wird Chef des Online-Branchenverbands
Swico, der Verband der ICT- und Online-Branche, erhält einen neuen Geschäftsleiter: Jon Fanzun, zuletzt Generalsekretär der FDP Schweiz, wird sein neues Amt am 1. August antreten. Laut Swico-Präsident Adrian Müller bringt Fanzun «eine wertvolle Kombination aus politischem Scharfsinn und technologischem Verständnis mit» für seinen neuen Job.
Bei der FDP muss Jon Fanzun den Platz nach zweieinhalb Jahren und einem verlorenen Wahlkampf zu Gunsten von Jonas Projer räumen. Der ehemalige «Arena»-Moderator Projer war, nach einem Abstecher bei «Blick-TV», zuletzt Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» gewesen.
Bei Swico folgt Jon Fanzun auf Judith Bellaiche. Bereits Anfang Jahr war bekannt geworden, dass die im Herbst abgewählte Zürcher GLP-Nationalrätin den Verband nach rund fünf Jahren als Geschäftsführerin verlassen wird. Sie will sich laut Mitteilung neu orientieren. (sat)
17:50 Uhr
Donnerstag, 16. Mai
Knall am Insel-Spital in Bern: Der Chef muss gehen
Am Donnerstagnachmittag wurden die Mitarbeitenden des finanziell angeschlagenen Berner Insel-Universitätsspitals informiert, dass der Chef abgesetzt wurde. «Die Insel-Gruppe kommt nun in eine neue Phase, in der das Vertrauen zwischen Direktion und Mitarbeitenden gestärkt werden muss», heisst es im Schreiben, das CH Media vorliegt. Es brauche Personen an der Spitze, die die Mitarbeitenden und das Kader hinter sich zu vereinen und zu motivieren verstünden. «Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Arbeitsverhältnisse mit Direktionspräsident Uwe Jocham und mit dem medizinischen Direktor Urs Mosimann aufzulösen», heisst es weiter.
Bis zur Regelung einer definitiven Nachfolge setzt der Verwaltungsrat nach eigenen Angaben «ab sofort» eine interimistische Leitung ein. Diese bestehe aus dem Rektor der Universität Bern, Christian Leumann, sowie aus dem Insel-Verwaltungsratspräsidenten und früheren grünen Regierungsrat Bernhard Pulver.
Am Abend bestätigte die Insel-Gruppe die Informationen in einer Medienmitteilung. Darin dankt sie Jocham und Mosimann für die langjährige Zusammenarbeit und die «grossen Leistungen zur Zukunftssicherung der Insel Gruppe». Nun gehe es um die «Hebung der Potenziale» der neuen Klinik-Software Epic und dem neuen Hauptgebäude, der Weiterentwicklung der Organisation und dem gemeinsamen Umsetzen der künftigen Unternehmensstrategie. (fv)
14:29 Uhr
Donnerstag, 16. Mai
EU untersucht, ob Instagram Jugendliche und Kinder gefährdet
Die Europäische Kommission eröffnet wegen des Verdachts auf Verstösse gegen den Jugendschutz ein Verfahren gegen den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta. Es gebe die Befürchtung, dass die Gestaltung der Dienste einschliesslich ihrer Algorithmen bei Kindern ein Suchtverhalten auslösen könnten, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit.
Befürchtet werden demnach insbesondere ein sogenannte Rabbit-Hole-Effekte (auf Deutsch: Kaninchenbau). Damit ist gemeint, dass man sich so tief in einem Thema verliert, dass man nicht mehr herausfindet – ähnlich wie sich die Hauptfigur in der Geschichte Alice im Wunderland in einem Kaninchenbau verliert. Algorithmen - vereinfacht gesagt von Menschen geschriebene Anleitungen für Computer - können theoretisch solche Verhaltensmuster erkennen und ausnutzen, damit Nutzerinnen und Nutzer mehr Zeit auf einer Plattform verbringen.
Online-Plattformen werden von einem neuen EU-Gesetz über digitale Dienste (DSA) unter anderem verpflichtet, Minderjährige besonders zu schützen. Es verbietet, sie gezielt mit Werbung anzusprechen, die auf persönlichen Daten beruht. Ausserdem müssen Risiken bewertet und abgeschwächt werden, die Schwächen und die Unerfahrenheit von Minderjährigen ausnutzen und süchtiges Verhalten verursachen.
Die Kommission hat Zweifel, dass Meta diesen Regeln zum Jugendschutz ausreichend nachkommt. Auch die Methoden des Konzerns zur Alterskontrolle gäben Anlass zur Sorge. Diese seien möglicherweise nicht wirksam. Die Kommission will nun weiter Beweise sammeln, etwa durch Befragungen. Mit der Einleitung des Verfahrens werde zunächst nur ein Verdacht geprüft, das Ergebnis steht noch nicht fest. ( dpa ) Auch in der Schweiz wird diskutiert, ob Smartphones und mit ihnen Socialmedia an Schulen verboten werden sollten.
09:33 Uhr
DONNERSTAG, 16. MAI
Neuer Chef für Easyjet – und ein Verlust
Easyjet-Chef Johan Lundgren gibt seinen Posten ab. Nach sieben Jahren als CEO werde er Easyjet Anfang 2025 verlassen, teilt die Fluggesellschaft mit. Nachfolger wird Kenton Jarvis, der derzeit Finanzchef bei Easyjet ist.
Für das Winterhalbjahr (Geschäftshalbjahr bis 31. März) weist Easyjet einen Verlust vor Steuern von rund 350 Millionen Pfund aus. Damit konnten die Winterverluste im Vergleich zur Vorjahresperiode verringert werden. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft: Die starke Nachfrage für den Sommer 2024 werde voraussichtlich zu starkem Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2024 führen. (mjb)
09:18 Uhr
DONNERSTAG, 16. MAI
Schweizer Wirtschaft wächst unterdurchschnittlich
Die Wirtschaft hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 unterdurchschnittlich entwickelt. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) dürfte um rund 0,2 Prozent gewachsen sein, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Damit setze die Schweizer Wirtschaft die verhaltene Entwicklung der letzten drei Quartale fort, schreibt das Seco. Einem Wachstum vom Dienstleistungssektor steht laut Mitteilung eine schwache Entwicklung der Industrie gegenüber.
Bei den Angaben handelt es sich um eine Schnellschätzung («Flash-BIP»), welche das Seco neuerdings erstellt. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Aktualisierte Daten und ausführliche Ergebnisse gibt das Seco zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. (mjb)
07:58 Uhr
Donnerstag, 16. Mai
Weko einigt sich mit Mastercard auf Kartengebühr
Wenn ein Händler Debitkarten als Zahlungsmittel akzeptiert, muss er Gebühren abliefern. Eine davon ist die sogenannte Interchange-Gebühr (siehe Grafik). Sie fliesst an die Kartenherausgeber, etwa eine Bank. Sie soll das Geld in Innovationen investieren. Für den Konsumenten ist die Höhe dieser Gebühr wichtig, weil sie einen - wenn auch geringen - Einfluss auf den Ladenpreis eines Produkts hat. Ein Beispiel: Bei einem Gipfeli für 1,50 Franken geht ein Rappen als Interchange-Gebühr weg. Das muss der Händler einkalkulieren.
Für das sogenannte Präsenzgeschäft senkt die Wettbewerbskommission (Weko) nun diese Interchange-Gebühr auf 0,12 Prozent. Die Obergrenze liegt bei Transaktionsbeträgen ab 300 Franken bei 30 Rappen.
Der von der Weko definierte Satz ist deutlich tiefer als jener in Europa. Dort beträgt er 0,2 Prozent. Die einvernehmliche Lösung mit Mastercard soll laut Weko «allen Betroffenen Rechtssicherheit bei Innovationen bieten. Deshalb kann sie erst im Jahr 2033 gekündigt werden.»
Tiefer in die Tasche greifen müssen die Händler, wenn ihre Kundschaft mit dem Mobiltelefon bezahlt oder im Internet einkauft. Hier hat die Weko einen Satz von 0,31 Prozent zugelassen. Er wird zwar ab November 2025 auf 0,28 Prozent reduziert. Dennoch ist Severin Pflüger vom Verband Elektronischer Zahlungsverkehr empört: «Es gibt keine rationale Begründung dafür, weshalb der Einsatz der gleichen Karte im Internet oder auf dem Smartphone fast dreimal so teuer wie im Laden sein soll. Der Nutzen ist der gleiche, die Technik ist dieselbe. Das ist für den Handel und die Konsumenten ein schlechter Entscheid.»
Keinen Einfluss hat der Weko-Beschluss auf den andauernden Streit zwischen den Wettbewerbshütern und dem Mastercard-Konkurrenten Visa. Dort konnte zuerst keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, Visa wehrte sich gar juristisch dagegen, dass auch bei ihren Debitkarten die Interchange-Gebühr gesenkt werden sollte. Visa argumentiert, man habe bereits eine Korrektur auf 0,2 Prozent vorgenommen, den regulierten europäischen Wert. «Dass die Weko sich nun auf einen massiv tieferen Satz eingeschossen hat, ist nicht nachvollziehbar», sagte Visa-Schweiz-Chef Santosh Ritter kürzlich im Interview mit CH Media.
Das Bundesverwaltungsgericht lehnte die Beschwerde von Visa zwar ab. Doch der Finanzkonzern kann noch vor Bundesgericht ziehen. Ob er das tun wird, ist nicht bekannt. Bei Visa heisst es auf Anfrage, man befinde sich im «konstruktiven Dialog mit der Weko» und sei «zuversichtlich eine einvernehmliche Lösung zu erreichen». (mpa)
07:18 Uhr
Donnerstag, 16. MAI
Swiss Re vermeldet Gewinn
Der Rückversicherer Swiss Re ist gut ins Jahr 2024 gestartet: Er erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar. «Unsere wichtigsten Geschäftsbereiche haben alle starke Ergebnisse verzeichnet», wird CEO Christian Mumenthaler in der Mitteilung zitiert. Für das Jahr 2024 strebt das Unternehmen einen Gewinn von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar.
Gleichzeitig gab Swiss Re am Donnerstag den Rückzug aus dem iptiQ-Geschäft bekannt. Die Swiss Re-Tochtergesellschaft iptiQ ist eine 2014 gegründete Digitalversicherungsplattform. Swiss Re werde Optionen für die verschiedenen iptiQ-Einheiten prüfen, kündigt das Unternehmen an. Das aktuelle Marktumfeld unterscheide «sich erheblich von dem zur Zeit der Gründung von iptiQ», heisst es zur Begründung. Swiss Re sei nicht mehr der beste Eigentümer für dieses Geschäft. (mjb)
14:00Uhr
Mittwoch, 15. Mai
16,4 Milliarden Franken für Bahn-Infrastruktur
Der Bund will den Bahnen für die Jahre 2025 bis 2028 mehr Geld für den Erhalt und die Erneuerung des Schienennetzes bereitstellen als ursprünglich geplant. Wie er am Mittwoch mitteilte, beantragt er dem Parlament einen Zahlungsrahmen von 16,4 Milliarden Franken. Das sind 2 Milliarden Franken mehr als in der laufenden Vierjahresperiode und 1,3 Milliarden Franken mehr, als die Regierung noch in der Vernehmlassung vorgeschlagen hatte.
Am früheren Vorschlag hatten unter anderem die SBB Kritik geübt , die den vorgesehenen Betrag als zu tief erachteten. Es drohe mittel- bis langfristig eine Überalterung und eine eingeschränkten Verfügbarkeit der Infrastruktur, wenn die Gelder nicht erhöht würden. Auch eine Mehrheit der Teilnehmer der Vernehmlassung, darunter 23 Kantone, bezeichneten den ursprünglich vorgeschlagenen Betrag als zu tief.
Wie der Bundesrat schreibt, könne mit der nun beantragten Erhöhung nicht nur die Teuerung ausgeglichen werden, es stünden auch real mehr Mittel zur Verfügung. Das ermögliche es etwa, baureife Projekte für den barrierefreien Zugang von Menschen mit Beeinträchtigung umzusetzen.
Mit der gleichen Vorlage beantragt der Bundesrat beim Parlament einen Kredit von 185 Millionen Franken, mit dem in den Jahren 2025 bis 2028 private Güterverkehrsanlagen gefördert werden sollen. Damit soll die bisherige Förderung des Gütertransports auf der Schiene und die Verlagerung des Güterverkehrs durch die Alpen fortgeführt werden. (ehs)
12:23 Uhr
Mittwoch, 15. Mai
Fenaco spürt die Turbulenzen an den internationalen Rohstoffmärkten
Dünger, Saatgut, Lebensmittel, Agrola-Tankstellen und ein Netz an Volg- und Landi-Läden: Das ist das breit gefächerte Geschäft des Agroriesen Fenaco, der am Mittwoch für 2023 das zweitbeste Resultat seiner 30-jährigen Geschichte vorlegen konnte: Der Umsatz betrug 7,54 Milliarden Franken, das Betriebsergebnis (Ebit) 107 Millionen Franken. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 97 Millionen Franken.
Beim Umsatz und Ebit kommt bei der Fenaco-Gruppe, die insgesamt über 11'300 Mitarbeitende zählt, nicht an die Vorjahresergebnisse heran. Der Rückgang hier sei mehrheitlich preisbedingt, sagte Konzernchef Martin Keller vor den Medien in Bern. Das heisst: Der Preisrückgang an den internationalen Rohstoffbörsen für Brenn- und Treibstoffe sowie Getreide hat zum einen die Verkaufserlöse geschmälert und machte zum anderen negative Korrekturen bei den Lagerbewertungen nötig.
Die nervösen Rohstoffmärkte, wetterbedingte Ernteausfälle, striktere Auflagen im Pflanzenschutz - all das dürfte Fenaco auch im laufenden Jahr beschäftigen, wie Keller weiter ausführte. «Die Kostensituation dürfte angespannt bleiben.» Er rechnet für 2024 mit einem etwa gleichbleibenden Umsatz. Beim Ebit und Gewinn geht er gar von einer leichten Verbesserung aus. (fv)
10:56 Uhr
Mittwoch, 15. Mai
Mitten im Ausverkauf: Migros stimmt verbessertem Sozialplan zu
Seit Februar ist bekannt: Die Migros will mehrere Tochterunternehmen und Fachmärkte loswerden. Betroffen von dem historischen Ausverkauf beim Orangen Riesen sind bis zu 1500 Stellen. Bereits bei der Verkaufsankündigung versprach die Migros-Spitze, dass sie trotz Verkauf gut zu ihren scheidenden Mitarbeitenden schauen wolle.
Nun teilt die Migros mit, dass sie erstmals einen einheitlichen Sozialplan für alle ihre Mitarbeitenden ausgearbeitet hat. Mit Blick auf die Verkäufe einzelner Unternehmen «nimmt die Migros damit ihre soziale Verantwortung als Arbeitgeberin wahr», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Sozialplan gilt demnach rückwirkend seit Anfang Monat.
Nebst der Migros haben dem Sozialplan auch die internen und externen Sozialpartner bereits zugestimmt, darunter die Landeskommission, der Metzgereipersonal-Verband und der Kaufmännische Verband (KV). Das neue Vertragswerk bringt laut Migros «für alle betroffenen Mitarbeitenden eine deutliche Verbesserung» im Vergleich zu bisherigen Sozialplänen einzelner Migros-Genossenschaften und -Firmen.
Der Verband KV Schweiz nennt die Einigung auf einen neuen Sozialplan in einer Mitteilung vom gleichen Tag einen «Meilenstein». Zentrale Punkte ist die Unterstützung bei der Suche nach Anschlussmöglichkeiten für langjährige und über 50-jährige Mitarbeitende. Diese sollen zudem «weitreichende Unterstützung» für Weiterbildungen oder bei einem Stellenwechsel Beiträge an Mobilitätskosten erhalten. (sat)
10:47 Uhr
Mittwoch, 15. Mai
Lucas Stäger wird neuer Stiftungspräsident der Krankenkasse Sanitas
Wechsel an der Spitze der Stiftung Sanitas Schweiz: Felix Gutzwiller, Präventivmediziner, emeritierter Professor der Universität Zürich und ehemaliger langjähriger FDP-Ständerat, tritt nach neun Jahren von der Spitze der Eigentümerin der Krankenversicherung Sanitas ab. Wie der Stiftungsrat am Mittwoch mitteilt, hat er Luca Stäger zu seinem neuen Präsidenten gewählt.
Der neue Stiftungspräsident ist seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats der Krankenkasse und seit 2018 dessen Vizepräsident. Mit der Wahl an die Spitze des Stiftungsrats verlässt der Ökonom den Verwaltungsrat. Stäger ist seit 14 Jahren CEO der Tertianum-Gruppe. Davor war er etwa Direktionspräsident der Schweizer Paraplegiker-Gruppe in Nottwil. (sat)
10:02 Uhr
Mittwoch, 15. Mai
Post im ersten Quartal mit mehr Gewinn – Postfinance büsst ein
Die Post hat im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Betriebsergebnis (Ebit) von 87 Millionen Franken erwirtschaftet. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt, ist das ein Plus von 17 Millionen gegenüber der Vorjahresperiode. Auch der Gewinn des Unternehmens in Staatsbesitz fällt im Vergleich zum Vorjahr mit 84 Millionen fast doppelt so hoch aus wie im Vorjahr.
Gleichzeitig mit der Post kommuniziert auch deren Tochterunternehmung Postfinance ihr Quartalsergebnis. Demnach konnte das Finanzinstitut in den ersten drei Monaten 2024 zwar ein paar wenige Kundinnen und Kunden hinzugewinnen. Gleichzeitig verlor Postfinance jedoch 2 Milliarden Franken an Kundenvermögen. Während der Betriebsertrag innert Jahresfrist um 77 auf 511 Millionen Franken anstieg, sank das Betriebsergebnis im ersten Quartal von 53 auf 41 Millionen.
Wie der Mutterkonzern Post weiter schreibt, bleiben die bekannten Herausforderungen im Kerngeschäft dieselben wie bereits in den vergangenen Jahren. So ging die Brief-Menge im ersten Quartal um 5,6 Prozent weiter zurück. Weiterhin rückläufig waren die Zahlungen am Postschalter (-13 Prozent) oder versandte Pakete (-6,2 Prozent). (sat)
07:53 Uhr
Mittwoch, 15. Mai
Mit dem Zug nach Grindelwald & Co.: Berner Oberland Bahn mit Passagier-Rekord
Ihre Linien zählen zu jenen mit den meisten Verspätungen im Land. Dennoch ist die Berner Oberland Bahn (BOB) beliebt, und das wie nie zuvor. Wie die BOB am Mittwoch mitteilt, beförderte sie im vergangenen Jahr 6,7 Millionen Fahrgäste aus Interlaken Ost in die Tourismus-Hotspots Grindelwald, Lauterbrunnen oder zum Ausflugsziel Schynige Platte. Das sind 36,3 Prozent mehr Fahrgäste als im Vorjahr und «so viele wie nie zuvor», wie es in der Mitteilung weiter heisst.
Und auch der Verkehrsertrag der BOB sei «erfreulicherweise sogar überproportional zur Entwicklung der Fahrgäste» gestiegen, teilt das Unternehmen weiter mit. Nämlich auf 21,2 Millionen Franken. Zusammen mit der Schynige Platte Bahn erwirtschaftete die Berner Oberland-Bahnen AG damit einen Verkehrsertrag von 26 Millionen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein sattes Plus von 6,6 Millionen. (sat)
07:47 Uhr
Mittwoch, 15. Mai
Von der SBB zur BLS: Anja Riedle wird neue Leiterin Personenmobilität
Eine zweite Frau für die Geschäftsleitung der BLS: Wie das bernische Bahnunternehmen am Mittwoch mitteilt, hat der Verwaltungsrat Anja Riedle zur neuen Leiterin des Geschäftsbereichs Personenmobilität ernannt. Die 38-Jährige wird ihren Job im September antreten. Derzeit leitet sie die Lokwerkstätten von SBB Cargo im Rangierbahnhof Limmattal. Zuvor war sie unter anderem bei der Deutschen Bahn im Bereich Personenverkehr tätig gewesen.
In der achtköpfigen Geschäftsleitung der BLS wird Riedle auf Daniel Hofer folgen. Sie ist damit künftig die zweite Frau in dem Gremium.
Hofer seinerseits hat das bernische Bahnunternehmen bereits Ende Februar verlassen. Bis zur Wahl von dessen Nachfolge führt laut Homepage Ulrich Schäffeler bei der BLS den Bereich Personenmobilität. (sat)
11:00 Uhr
DIENSTAG, 14. Mai
Preisüberwacher kritisiert: Preis von Sonnenblumenöl sei zu hoch
Für eines der beliebtesten Speiseöle müssen die Konsumenten in der Schweiz tief in die Tasche greifen. Zu tief, wie Preisüberwacher Stefan Meierhans kritisiert. Im Gegensatz zu den Preisen in den deutschen Läden, würden die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten nicht aufatmen können: Sie zahlen Anfang 2024 noch immer ganze 20 Prozent mehr, als während der Spitzen der weltweiten Verknappung von Sonnenblumenöl.
Der Russische Angriffskrieg auf die Ukraine löste damals Versorgungsprobleme aus, die auch den Grosshandels-Preis für Sonnenblumenöl steigen liessen. Das spürten die Konsumenten unmittelbar, da die Detailhändler die höheren Preise an sie weitergaben. Bald fanden die Öllieferanten neue Wege, um die Versorgung mit Sonnenblumenöl wiederherzustellen, wie der Preisüberwacher schreibt. Das hatte auch für die Konsumenten positive Folgen: «Die tieferen Weltmarktpreise erlaubten es den Supermärkten, die Preise auf Vorkriegsniveau zu senken und somit ihre Kundschaft zu entlasten.»
Doch nicht überall können die Konsumentinnen und Konsumenten aufatmen. Der Preisüberwacher kritisiert, dass im Gegensatz zu den Preisen in den deutschen Läden, in der Schweiz die Preise nochmals gestiegen sind. Für den Preisüberwacher ist nicht klar, warum dies so ist. Probleme in der Schweizer Lieferkette seien keine bekannt.
Es sei darum nicht auszuschliessen, dass es sich um «Excuseflation» handle, so der Preisüberwacher. Das heisst, die allgemeine Inflation wird genutzt, um Preiserhöhungen durchzusetzen, obwohl die Produktionskosten nicht steigen. Das funktioniert deshalb, weil die Kundschaft die Produktionskosten nicht kennt und die hohen Preise aufgrund der allgemeinen Teuerung akzeptiert.
Der Preisüberwacher spekuliert, dass die marktwirtschaftlichen Mechanismen der Konkurrenz nicht spielen, weil Migros und Coop den Lebensmittelhandel dominierten. «Gut möglich, dass die hiesigen Konsumentinnen und Konsumenten für Sonnenblumenöl mehr zahlen, als sie sollten.» (wan)
10:26 Uhr
DIENSTAG, 14. Mai
Bund lässt nachrechnen: so viel Wert haben die Immobilien in der Schweiz
Das Bundesamt für Wohnungswesen und der Hauseigentümerverband haben nachrechnen lassen, wie wichtig die Immobilienwirtschaft für die Schweiz ist. Demnach umfasse der Gebäudepark rund 2,8 Millionen Gebäude, welche einen Erstellungswert von 3100 Milliarden Franken hätten. Das entspricht nicht ganz dem 4-fachen der gesamten jährlichen Wertschöpfung der Schweiz.
Zudem trage die Immobilienwirtschaft jährlich 11 Prozent an das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz bei. Würden noch die Mieteinnahmen und die Eigenmieten der privaten Haushalte hinzugezählt, belaufe sich der Anteil auf 16 Prozent des BIP. Des Weiteren würden 14 Prozent aller Beschäftigten in der Schweiz in der Immobilienbranche arbeiten.
Die Immobilienwirtschaft wächst deutlich schneller als die Gesamtwirtschaft. Zwischen 2011 und 2021 sei die immobilienbezogene Bruttowertschöpfung um 23 Prozent gestiegen, diejenige der Gesamtwirtschaft um 17 Prozent. Der Gebäudebestand sei zwischen 2011 und 2022 von 2,66 auf 2,82 Millionen Gebäude angestiegen. Dabei was das prozentuale Wachstum bei den Mehrfamilienhäusern mit 15,5 Prozent höher, als bei den Einfamilienhäusern mit 6,1 Prozent. Ein Drittel aller Gebäude seien in den drei Kantonen Bern, Zürich und Aargau zu finden. ( nav )
09:13 Uhr
DIENSTAG, 14. Mai
Mehr Biobetriebe sowie weniger Kühe und Schweine
532'300 Milchkühe zählte das Bundesamt für Statistik 2023 in der Schweiz, das sind 2 Prozent weniger. Wohingegen die Zahl der Mutterkühe zur Rindfleischproduktion stieg. Auch die Zahl der Schweine ging 2023 um 3,5 Prozent auf 1 324 400 Tiere zurück. Der zuletzt starke Anstieg an der Geflügelhaltung flachte zuletzt ab. In der Schweiz lebten vergangenes Jahr 3,8 Millionen Legehennen und 18,1 Millionen Mastpoulets.
Während sich der Strukturwandel in der Landwirtschaft weiter fortsetzt und 625 Bauernhöfe den Betrieb aufgaben, nimmt die Zahl der Bio-Betriebe zu. Gemäss Statistiker des Bundes werden von den 47'719 Landwirtschaftsbetrieben 16,5 Prozent (7896 Bauernhöfe) nach den Richtlinien des Biolandbaus betrieben. Das waren 77 Einheiten oder 1 Prozent mehr als noch im Vorjahr. (wan)
07:43 Uhr
Dienstag, 14. Mai
180 Personen vor Entlassung: Vetropack schliesst Werk in der Waadt
Vetropack, einer der grössten Glasverpackungshersteller Europas, will den Standort in St-Prex (VD) mit rund 180 Mitarbeitenden schliessen , wie der Hersteller per Mitteilung bekannt gibt. Es werde das Konsultationsverfahren für die Zukunft der Produktionsstätte eröffnet. Das Unternehmen habe mit «umfassenden Analysen» geprüft, ob der Weiterbetrieb des Werks noch möglich ist. Das Ergebnis sei negativ ausgefallen. Der Entscheid für die Schliessung fällt der Verwaltungsrat nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationsverfahren. Für die betroffenen Mitarbeitenden wird ein Sozialplan vorbereitet. (wan)
07:07 Uhr
Montag, 14. Mai
Hörgerätehersteller Sonova steigert Umsätze im Ausland
Die Sonova Gruppe setzte im Geschäftsjahr 2023/2024 3626,9 Millionen Franken um. Gemessen am Ergebnis des Vorjahres handelt es sich um einen Rückgang um 3 Prozentpunkte. Sonova weist ein EBITA von 771,4 Millionen Franken aus.
Der Hörgerätehersteller teilt mit, nach einem schwierigen Start habe sich der Markt für Hörgeräte im Laufe des Jahres erholt. In Europa, im Mittleren Osten, Afrika und Amerika verzeichnet Sonova ein Umsatzwachstum. (wan)
15:02 Uhr
Montag, 13. Mai
Die halbe Belegschaft ist betroffen: Massenentlassung bei Pfizer in Zug
Bis zu 74 Kündigungen werden beim US-Pharmakonzern Pfizer in Zug ausgesprochen. Weitere 21 Personen sollen intern wechseln. Damit wiederholt sich die Geschichte: Nach grossen Zukäufen hat Pfizer stets Doppelspurigkeiten in Zug eliminiert.
15:30 Uhr
Montag, 13. mai
EU-Kommission: Striktere Regeln für Buchungsportal Booking
Das Buchungsportal Booking muss in der EU künftig strengere Regeln einhalten. Der zentrale Plattformdienst stelle eine wichtige Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verbrauchern dar, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Daher sei Booking als sogenannter Gatekeeper einzustufen und müsse unter anderem Nutzern mehr Auswahl und Freiheit bieten.
Die sogenannten Gatekeeper (Torwächter) sind die grössten Online-Plattformen. Für sie gilt seit Anfang März das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA). Die Grundannahme ist, dass die grossen Plattformbetreiber so mächtig geworden sind, dass sie ihre Marktposition zementieren könnten. Der DMA soll dies mit Regeln für sie aufbrechen und für mehr Wettbewerb bei digitalen Diensten und bessere Chancen für neue Rivalen sorgen. Betroffen sind bereits zahlreiche Unternehmen, darunter auch die US-Schwergewichte Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta.
Nach Angaben der EU-Kommission hat Booking nun sechs Monate Zeit, um die entsprechenden Verpflichtungen zu erfüllen und einen Bericht dazu vorzulegen. Bei Verstössen gegen den DMA drohen Strafen von bis zu 10 Prozent des jährlichen Umsatzes – und bis zu 20 Prozent im Falle wiederholter Verletzungen. Als letzte Option steht auch eine Zerschlagung im Raum. Am Ende könnten Gerichte über mögliche Strafen entscheiden. ( dpa )
14:27 Uhr
Montag, 13. Mai
In Europa verlangsamt sich der Kaffeepreisanstieg
Es mag der nächste Kaffeepreisschock drohen, weil eine wichtige Kaffeebohnen gerade auf einem 45-Jahre-Preishoch steht. Doch zumindest klingen die letzten Schocks auf den Kaffeepreis gerade ab. Die Kaffeepreise steigen in der Europäischen Union gerade weniger stark als noch letztes und vorletztes Jahr.
Im März 2024 sei die Jahresteuerung auf den Kaffeepreis, welche Konsumenten in der EU bezahlen müssen, auf 1 Prozent abgesunken. Das meldet Eurostat, die Europäische Statistikbehörde. Kaffee wurde also noch immer teurer, aber weniger stark als im März 2023, als es um 13,5 Prozent in die Höhe ging. Den grössten Kaffeepreisschocker gab es im Oktober 2022 mit einem Jahresanstieg von 17,4 Prozent.
Doch die Unterschiede hinter dem EU-weiten Durchschnitt sind gross. Die grösste Kaffeepreis-Inflation hatte Kroatien mit 7.4 Prozent, während Finnland den grössten Preisrückgang erlebte mit 15,5 Prozent. Die Preisanstiege waren zu einem guten Teil die Folge von Wetterextremen in Anbauländern wie Vietnam oder Brasilien . (nav)
09:14 Uhr
MONTAG, 13. MAI
Vorwürfe gegen Billigkleiderhersteller Shein
Public Eye hat vor zweieinhalb Jahren zu den Arbeitsbedingungen beim chinesischen Billigkleiderhersteller Shein und deren Zulieferer nachgeforscht. Dabei stiess die Nichtregierungsorganisation auf Arbeitswochen von 75 Stunden, welche nicht vereinbar seien mit dem Verhaltenskodex von Shein und mit dem chinesischen Arbeitsgesetz.
Seither habe Shein immer wieder Besserung gelobt - davon habe Public Eye jedoch bei einer abermaligen Recherche nichts erkennen können. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, hätten Interviews mit 13 Beschäftigten in der Stadt Guangzhou, wo viel Shein-Ware produziert werde, wiederum ein tristes Bild gezeigt: es gebe weiterhin Arbeitszeiten von «8 Uhr morgens bis in die Nacht, also täglich zwölf Stunden an zumindest sechs, meist aber sogar sieben Tagen die Woche». (nav)
08:39 Uhr
Montag, 13. Mai
Big Pharma erhöht Forschungsgelder
Wie viel Profit zieht die Pharmaindustrie aus ihren Investitionen in Forschung und Entwicklung? Dieser Frage ist das Beratungsunternehmen Deloitte Schweiz nachgegangen. Gemäss einer neuen Analyse haben die 20 grössten Pharmafirmen letztes Jahr 4,1 Prozent Forschungsrendite erzielt. Das ist deutlich mehr als noch im Jahr 2022, als die Zahl auf einem Rekordtief von 1,2 Prozent lag.
Ebenfalls angestiegen sind die absoluten finanziellen Investitionen in die Forschung und Entwicklung. Im Geschäftsjahr 2023 investierten die berücksichtigten Unternehmen – darunter Roche und Novartis – 145 Milliarden Dollar in ihr Kerngeschäft. Das entspricht einem Anstieg von 4,5 Prozent. Den gestiegenen Forschungsaufwand begründet Deloitte mit «komplexeren Studienanforderungen und regulatorischen Änderungen». (mpa)
14:40 Uhr
Freitag, 10. Mai
Geldstrafen gegen 7 Manager im Postauto-Skandal
Im Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts auf Subventionsbetrug bei Postauto hat das Bundesamt für Polizei (Fedpol) Strafverfügungen gegen 7 Beschuldigte erlassen. 5 frühere Postauto-Geschäftsleitungsmitglieder wurden wegen «mehrfachen Leistungsbetruges» schuldig gesprochen, wie das Fedpol gestern bekannt gab. Zudem wurde je eine Person aus der ehemaligen Post-Konzernleitung sowie aus dem Post-Verwaltungsrat schuldig gesprochen, weil sie den Leistungsbetrug nicht verhindert haben. Die Strafen umfassen bedingte Geldstrafen zwischen 56'000 und 420'000 Franken sowie unbedingt ausgesprochene Bussen zwischen 12'000 und 60'000 Franken.
Die Strafverfügungen sind nicht rechtskräftig. Denn die 7 Personen können nun innert zehn Tagen die Beurteilung durch das Strafgericht verlangen. (fv)
10:31 Uhr
Freitag, 10. Mai
56-Millionen-Ausgleich für CS-Aktien ? Gericht sieht sich nicht zuständig
Die von Bund, Nationalbank und Bankenaufsicht Finma aufgegleiste Not-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im März 2023 beschäftigt weiterhin die Gerichte. Jüngstes Beispiel: Das Bezirksgericht Zürich lehnt die Forderung eines ehemaligen CS-Aktionärs nach einer Ausgleichszahlung von 56 Millionen Franken durch die UBS ab. Oder besser gesagt: Es tritt gar nicht auf die Forderung des Besitzers von 5’027’521 CS-Aktien ein. Begründung: Es sei nicht zuständig.
Wie das Bezirksgericht am Freitag in einer Mitteilung schreibt, ist es - wenn schon - am Handelsgericht zu beurteilen, ob der im Fusionsvertrag festgelegte Tausch von 22,48 CS-Aktien gegen 1 UBS-Aktie zu tief sei. Gegen diese Vereinbarung sind beim Handelsgericht Zürich laut früheren Medienberichten bereits über zwei Dutzend Klagen eingegangen.
Für Streitigkeiten aus der Fusion zweier Handelsgesellschaften sei im Kanton Zürich das «für spezifisch handelsrechtliche Fragen geschaffene Handelsgericht grundsätzlich zwingend zuständig», schreibt das Bezirksgericht in einer Mitteilung zum Entscheid. Dies gelte auch, wenn der Kläger nicht im Kanton Zürich im Handelsregister eingetragen ist. Wer der Kläger ist, gibt das Gericht nicht Preis.
Klar ist hingegen, dass der Beschluss noch nicht rechtskräftig ist. Er kann beim Obergericht des Kantons Zürich angefochten werden. (sat)
09:22 Uhr
Mittwoch, 8. Mai
Haefner-Vertrauter Widmer verlässt Amag-Verwaltungsrat nach 31 Jahren
Im Verwaltungsrat der Amag kommt es zu einem gewichtigen Wechsel: Peter Widmer hat nach 31 Jahren das strategische Gremium der grössten Automobilimporteurin des Landes verlassen. Als Nachfolger wählte die Generalversammlung vom Dienstag Roman Sonderegger.
Wie die Amag am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, trat Widmer 1993 noch zur Zeit des Amag-Gründers Walter Haefner in den Verwaltungsrat der damaligen Automobil- und Motoren AG ein. Amag-Präsident Haefner dankt Widmer in der Mitteilung für seine «wertvollen Dienste» und dessen «unermüdlichen Einsatz».
Roman Sonderegger ist seit eineinhalb Jahren Chef der Schweiter Technologies AG. Die in Steinhausen (ZG) ansässige Unternehmensgruppe ist weltweit im Bereich Verbundstoffe tätig. Nebst dem Präsidenten und Eigentümer besteht der Amag-Verwaltungsrat aus fünf externen und unabhängigen Mitgliedern. (sat)
07:50 Uhr
Mittwoch, 8. Mai
Trotz warmem Winter: Schweizer Skigebiete zählen mehr Eintritte
Der erste Schnee fiel zwar früh vom Himmel, doch dann war es vielerorts grün. Dennoch war der abgelaufene Winter für die Skigebiete hierzulande ein erfolgreicher, wie der Verband Seilbahnen Schweiz am Mittwoch mitteilte. Über das ganze Land gesehen stieg die Zahl der Ersteintritte in den Skigebieten nämlich um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt wurden sogar 5 Prozent mehr Ersteintritte gezählt.
Erneut zeigen sich laut Seilbahnen Schweiz jedoch grosse regionale Unterschiede. In den Ostschweizer Skigebieten wurde mit 9 Prozent mehr Eintritten das grösste Plus gemessen. Ein Plus von je 5 Prozent gab es in den Skigebieten der Zentralschweiz und in den Waadtländer Alpen.
Dank sehr guten Schneeverhältnissen im Frühling konnte das Tessin die Saison trotz schlechten Starts nur noch leicht negativ (-1 Prozent) abschliessen. Richtig negativ ist die Entwicklung im Jura (-26 Prozent) und in den Freiburger Alpen (-31 Prozent).
Auch im Fünf-Jahres-Vergleich sind es der Jura (-80 Prozent) und die Freiburger Alpen (-43 Prozent) die am stärksten unter dem Einbruch der Ski-Eintritte leiden. Aber auch das Berner Oberland weist mit -13 Prozent eine negative Fünf-Jahres-Bilanz aus. Über zusätzliche Eintritte dürfen sich derweil besonders die Tessiner (+28 Prozent), Walliser (+10 Prozent) und Bündner (+9 Prozent) Skigebiete freuen. (sat)
07:06 Uhr
Mittwoch, 8. Mai
Arbonia-Finanzchef wechselt zu DocMorris
Nachdem sich Arbonia entschieden hat, den Climate-Bereich zu verkaufen und sich auf das Türengeschäft zu fokussieren, muss der Gebäudezulieferer einen neuen Finanzchef suchen. Im Nachgang zu dem Verkauf habe sich nämlich Daniel Wüest nämlich entschieden, seine Funktion als Group CFO nach fünf Jahren wieder abzugeben, teilte das weltweit tätige Unternehmen mit Sitz in Arbon (TG) am Mittwoch mit.
Gleichzeitig meldet DocMorris, dass Wüst neuer Finanzchef der Versandapotheke werde. Der Verwaltungsrat habe den scheidenden Arbonia-CFO zum Nachfolger von Marcel Ziwica als neuen Finanzchef von DocMorris berufen. Der 54-jährige Wüest wird seinen neuen Job per 1. Oktober 2024 antreten. Der 49-jährige Ziwica will 2024 nach 23 Jahren im Unternehmen nochmals eine neue Herausforderung ausserhalb des an der Schweizer Börse notierten Arzneimittelvertriebsunternehmen annehmen.
Arbonia wie auch DocMorris verdanken in ihren Mitteilungen die Arbeit der jeweiligen bisherigen Finanzchefs und bedauern die Abgänge. (sat)
16:17 Uhr
Dienstag, 7. Mai
Lufthansa-Chef: 1800 Neueinstellungen bei der Swiss
Die Fluggesellschaft Swiss hat ein Rekordjahr hinter sich. Nie hat sie mehr Gewinn erwirtschaftet. Und auch im ersten Quartal 2024 resultierte – im Gegensatz zu vielen anderen Airlines – ein ordentlicher Profit. Um die grosse Nachfrage weiterhin bedienen zu können, ist die Swiss allerdings auf genügend Angestellte angewiesen.
Das weiss auch Carsten Spohr, Chef der deutschen Muttergesellschaft Lufthansa. In einem Podiumsgespräch am St.Gallen Symposium sagte der langjährige Manager kürzlich: «Alleine für die Swiss werden wir dieses Jahr 1800 Leute einstellen.» Das sei praktisch eine undenkbare Zahl für eine Airline mit der Grösse der Swiss. Für die gesamte Lufthansa-Gruppe, zu der unter anderem auch Austrian Airlines und Edelweiss gehören, rechnet Spohr derweil mit 13'000 Neueinstellungen.
Auf Nachfrage von CH Media sagt Swiss-Sprecher Michael Stief, bei Spohrs Prognose handle es sich um eine gerundete Zahl. Für die Kabine suche man 2024 rund 1000 neue Flight Attendants, 80 Pilotinnen und Piloten sowie 600 Angestellte für die verschiedenen Bereiche am Boden. Im Schnitt erhalte die Swiss rund 40 Bewerbungen pro ausgeschriebene Stelle. «Für unsere offenen Stellen in der Kabine erhalten wir wöchentlich sogar Bewerbungen im dreistelligen Bereich.» Aktuell sei man mit der Besetzung der Stellen auf Kurs.
Die Job-Investitionen bei der Swiss sind für den Lufthansa-Konzern attraktiv. Laut einer Analyse von SRF verdient der Kranich-Konzern mit seiner eigenen Marke nur etwas mehr als 14 Euro pro Passagier. Bei der Swiss sind es mit 41 Euro fast dreimal mehr. Gegenüber dem Sender sagt Spohr denn auch: «Die Swiss konzentriert sich mit ihren Langstrecken-Flugzeugen sehr stark auf die profitabelsten Märkte der Welt.»
Dass die Schweiz ein interessanter Markt sei, habe nicht zuletzt mit der hohen Kaufkraft der hier lebenden Bevölkerung zu tun. Und: «Die Lufthansa-Gruppe wäre nicht das, was sie ist, ohne die Swiss.». Dasselbe gelte auch umgekehrt: «Die Swiss wäre sicherlich auch nicht das, was sie ist, ohne die Lufthansa-Gruppe». (bwe)
08:41 Uhr
Dienstag, 7. Mai
Geberit leidet unter Frankenstärke
Der Sanitärtechnikkonzern Geberit mit Sitz in Rapperswil-Jona hat im ersten Quartal dieses Jahres 837 Millionen Franken umgesetzt, 6,2 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Gründe des Rückgangs sind ein leichter Rückgang der Volumen sowie die Frankenstärke. Ohne negative Währungseffekte in Höhe von 43 Millionen Franken wäre der Umsatz lediglich um 1,4 Prozent gesunken.
Über den Rückgang der Volumen schreibt Geberit, die Nachfrage und damit der Absatz in den Endmärkten sei weiterhin rückläufig. Als positiv vermerkt wird, dass der Grosshandel die Lagerbestände wieder aufbaue. Regional betrachtet nahmen die Umsätze im Hauptmarkt Europa währungsbereinigt um 2 Prozent ab, in allen aussereuropäischen Märkten legte Geberit dagegen zu.
Das Betriebsergebnis nahm im ersten Quartal um 7,5 Prozent oder 20 Millionen Franken auf 239 Millionen ab. Die operative Marge vermochte Geberit mit 28,6 (im Vorjahresquartal 29) des Umsatzes annähernd zu halten. Der Reingewinn sank um 11,4 Prozent oder 25 Millionen auf 190 Millionen Franken.
Für das ganze Jahr 2024 erwartet Geberit mit 11’000 Beschäftigten eine insgesamt rückläufige Bauindustrie, wobei sich der Neubau in der Schweiz besser entwickeln dürfte als jener in Deutschland und in Nordeuropa. Im Renovationsgeschäft geht Geberit von einem robusteren Verlauf aus. (T.G.)
07:45 Uhr
Dienstag, 7. Mai
Arbeitslosigkeit sinkt leicht
Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt ist weiterhin erfreulich. Wie das Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) am Dienstag meldet, ist die Arbeitslosenquote im April von 2,4 Prozent auf 2,3 Prozent gesunken. Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren Ende Monat 106’957 Arbeitslose gemeldet - rund 1600 weniger als noch im Vormonat.
Allerdings: Noch vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote noch tiefer. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 16’423 Personen oder 18,1 Prozent. Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz mit ihrer tiefen Quote aber weiterhin auf einem absoluten Spitzenrang.
Leicht gestiegen ist die Jugendarbeitslosigkeit. Dagegen sank die Anzahl der Arbeitslosen zwischen 50 und 64 Jahren ebenfalls leicht. (mg)
11:43 Uhr
Dienstag, 7. Mai
SFS akquiriert spanische Fachhändlerin
Der Rheintaler Technologiekonzern SFS hat per 1. Mai die spanische Firma Etanco erworben, eine Fachhändlerin für Verbindungselemente, Befestiger und weitere Produkte für die Gebäudehülle. Die Übernahme stärke die Position der SFS-Division Construction in Spanien und Portugal. Etanco hat im vergangenen Jahr mit zehn Mitarbeitenden rund vier Millionen Euro umgesetzt. Die SFS Group mit Sitz in Heerbrugg SG hat im vergangenen Jahr mit weltweit 13'200 Mitarbeitenden annähernd 3,1 Milliarden Franken umgesetzt. (T.G.)
11:36 Uhr
Montag, 6. Mai
Körner vor Absprung: Der letzte CS-Chef dürfte die UBS bald verlassen
Die UBS gibt bei der Integration der Credit Suisse Gas. Die Grossbank würde daran arbeiten, die Fusion der verschiedenen Rechtseinheiten von UBS und Credit Suisse bis Ende Mai abzuschliessen. Das jedenfalls schreibt die «Financial Times» mit Verweis auf Informationen von Personen, die mit den Plänen vertraut seien. Demnach werde der letzte Chef der Credit Suisse, Ulrich Körner, die UBS in den kommenden Wochen verlassen. Körner, der in den letzten Tagen des Jahres 2022 zum Nachfolger von Thomas Gottstein und zum Chef der Credit Suisse ernannt worden war und auch nach der Rettung der Bank durch die UBS in dieser Position bleiben konnte, wollte die Bank schon früher verlassen, wie es weiter heisst. Er sei aber dazu überredet worden, bis nach der rechtlichen Fusion zu bleiben. Die UBS wollte sich hierzu nicht äussern.
Klar ist aber, dass mit der Zusammenlegung der Holdinggesellschaften der beiden Banken die Geschäftsleitung der Credit Suisse obsolet wird, ebenso wie die Chefposition. Mit dem Abgang von Körner und der Auflösung der Holdinggesellschaft der Credit Suisse wird das letzte Kapitel in der Geschichte der 168 Jahre alten Bank geschrieben. Gemäss dem von UBS-Chef Sergio Ermotti im Februar vorgestellten Integrationsplan sollen die Schweizer Einheiten in der zweiten Jahreshälfte fusioniert werden, während die Kunden der Credit Suisse noch bis ins nächste Jahr hinein zu UBS migriert werden sollen. Der letzte Teil der Integration, die Zusammenführung der IT-Systeme, wird bis ins Jahr 2026 dauern.
Nach Abschluss der rechtlichen Fusion plant UBS einen verstärkten Stellenabbau, da die Bank nach Angaben von Personen, die mit den Plänen vertraut sind, bis zum Ende des Integrationsprozesses insgesamt 85’000 Mitarbeiter beschäftigen will. Basierend auf dem Personalbestand der kombinierten Gruppe von 120’000 im letzten Jahr würde die Gesamtzahl der abzubauenden Stellen 35’000 betragen. (fv)
10:00 Uhr
Montag, 6. Mai
29 Politiker verfassen offenen Brief gegen die Nationalbank
Im Nachgang zu ihrer Generalversammlung vom 26. April muss die Schweizerische Nationalbank (SNB) Kritik einstecken von insgesamt 29 National-, Stände- und Kantonsräte aus 9 Kantonen und 5 verschiedenen, mehrheitlich linken Parteien. In einem offenen Brief verurteilen diese das Vorgehen der Nationalbank. Diese hatte zwei Delegierten den Zutritt zur Generalversammlung verweigert, wie aus dem am Montag publizierten Schreiben hervorgeht: der argentinischen Anwältin Mariana Katz und Orlando Carriqueo, dem Botschafter des Mapuche-Volkes.
Die beiden hätten zwei Tage vor der Generalversammlung mit einem Mitglied des erweiterten SNB-Direktoriums gesprochen und hätten an der Generalversammlung auf die negativen «Folgen der Investitionen der SNB in Unternehmen» aufmerksam machen wollen, die durch die Förderung von Schiefergas und -öl durch Fracking entstünden. Fracking sei ein besonders umweltschädliches Verfahren, das bereits von 14 Schweizer Kantonen abgelehnt worden ist.
Die SNB hat sich bei ihrem Entscheid auf die Zugangsregel berufen, die besagt, dass Vertreter von Organisationen in deren Organisationsorganen sitzen müssen. Und das war bei den beiden nicht der Fall. Die Politiker monieren in ihrem offenen Brief, dass jedoch «kein anderer Delegierter einer Aktionärsorganisation auf diese Weise» ausgeschlossen worden sei, «weder in diesem noch in den letzten drei Jahren». Und weiter: «Warum verweigert man einer Anwältin, die Mitglied einer von einem Friedensnobelpreisträger gegründeten Organisation ist, und einem Sprecher eines indigenen Volkes, dessen Heimat von Unternehmen, an denen die SNB beteiligt ist, verwüstet wird, die Teilnahme und 3 Minuten Redezeit?»
Die Politiker fordern die Nationalbank zudem auf, die Beteiligungen an Unternehmen, «die der Natur und den indigenen und bäuerlichen Gemeinschaften Schaden zufügen», auszuschliessen. Zu den Unterzeichnern gehören verschiedene Ständeräte und Nationalräte der Grünen, darunter etwa der frühere Parteipräsident Balthasar Glättli, die Konsumentenschützerin Sophie Michaud Gigon, der Solothurner Felix Wettstein oder der Bundesratskandidat Gerhard Andrey. Zahlreich sind die Unterschriften aus der SP-Fraktion, etwa vom Genfer Carlo Sommaruga oder dem Zürcher Fabian Molina. Bei den Kantonspolitikern aus dem Kanton Genf haben auch mehrere Abgeordnete der Mitte und der SVP unterschrieben. (fv)
15:40 Uhr
Freitag, 3. Mai
Bühler-Konzern verkauft deutsches Werk
Der Technologiekonzern Bühler aus Uzwil SG hat einen Käufer gefunden für seine Anlagenbaufabrik im sächsischen Döbeln zwischen Dresden und Leipzig. Demnach hat die Beteiligungsgesellschaft Zachert Private Equity (ZPE) das Werk übernommen. Laut Mitteilung garantiert ZPE allen 70 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz und will das Werk, das offensichtlich einer Restrukturierung bedarf, strategisch weiterentwickeln. Es ist aktuell auf die Produktion von Anlagen vor allem für die Getreidelogistik spezialisiert.
ZPE wolle das Geschäftsmodell des Standorts Döbeln erweitern und weitere Unternehmen oder Unternehmensteile zukaufen. Bühler werde diesen Prozess durch langfristige Auftragszusagen unterstützen. Die Bühler GmbH sagt über den Verkauf, die Marktsituation zwinge die deutsche Tochter des Bühler-Konzerns dazu, ihre Kapazitäten am bayrischen Standort Beilngries zwischen München und Nürnberg zu konzentrieren. Bühler hatte die Absicht zum Verkauf des Werks in Döbeln vor einem Jahr angekündigt. (T.G.)
14:08 Uhr
Freitag, 3. Mai
Antoinette Hunziker-Ebneter gibt Leitung ab
Die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Vermögensverwaltungsfirma Forma Futura erhält neue Chefs: Die Co-Gründerin und bisherige Chefin, Antoinette Hunziker-Ebneter, gibt die operative Leitung an ein «Zweiergespann» ab, wie Forma Futura mitteilt. Neu wird das Finanzunternehmen von der Kundenbetreuerin Larissa Jäger und André Utzinger, der als Finanzchef bereits Mitglied der Geschäftsleitung war.
Hunziker-Ebneter, die auch Verwaltungsratspräsidentin der Berner Kantonalbank ist, wird weiterhin als Kundenberaterin tätig sein. Sie und Christian Kobler, die Forma Futura 2006 gegründet hatten, bleiben zudem als Verwaltungsräte und Kernaktionäre an Bord. (fv)
11:55 Uhr
Freitag, 3. Mai
Guetsli-Rochade: Das Ehepaar Kambly übernimmt
Beim traditionsreichen Guetsli-Hersteller Kambly mit Sitz im bernischen Trubschachen ist der Generationenwechsel vollzogen. Die operative Führung hatte das Ehepaar Dania und Nils Kambly in vierter Generation bereits 2010 übernommen. Nun übernimmt die Tochter von Oscar Kambly, dem Enkel des gleichnamigen Firmengründers, auch als neue Verwaltungsratspräsidentin. Ihr Ehemann Nils, der den Namen seiner Frau angenommen hat und als Geschäftsführer amtet, ist ihr Vizepräsident.
Dieser Schritt sei für das unabhängige Familienunternehmen ein Bekenntnis zur langfristigen Strategie, zum Standort Schweiz und zur regionalen Beschaffung der Zutaten für die Biscuits, heisst es in einer Medienmitteilung.
Tatsächlich sagte Dania Kambly bereits nach der operativen Stabsübergabe im Interview mit dieser Zeitung: «Über einen Verkauf haben wir nie konkret gesprochen, das war immer nur der Plan B, C oder sogar D. Unser Ziel ist es weiterhin, dass die Firma in Familienbesitz bleibt.»
Kambly bezeichnet sich selbst als umsatzstärkster Biscuithersteller der Schweiz. Mit 525 Mitarbeitenden erzielte das 1910 gegründete Unternehmen aus dem Emmental im vergangenen Jahr einen Umsatz von 201 Millionen Franken – 46 Prozent davon im Ausland in rund 50 Ländern. (bwe)
10:44 Uhr
Freitag, 3. Mai
Bieterkrieg um Bergbaukonzern: Steigt Glencore ein?
Es wäre der grösste Deal, den die Rohstoffbranche je gesehen hat: Der australische Bergbaukonzern BHP will den britischen Konkurrenten Anglo American übernehmen. Vor einer Woche schlug Anglo jedoch ein 39-Milliarden-Dollar-Angebot aus – wohl in der Hoffnung, einen besseren Preis herausholen zu können.
Diese Hoffnung bekommt nun neue Nahrung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Quellen berichtet, prüft auch der Schweizer Rohstoffriese Glencore eine Annäherung an Anglo American. Zwar habe sich Glencore noch nicht an Anglo gewandt, sagte eine der Quellen. Die Gespräche seien in diesem Stadium intern und vorläufig. Doch wenn der Rohstoffkonzern mit Sitz in Baar ZG einsteigt, könnte dies einen Bieterkrieg auslösen. Glencore erklärte auf Anfrage von Reuters nur: «Wir kommentieren keine Marktgerüchte oder Spekulationen.»
Das 107 Jahre alte Bergbauunternehmen Anglo American ist für die Konkurrenz wegen seiner Kupfervorkommen in Chile und Peru attraktiv. Das Metall ist zentral für die Energiewende und die Technologie der künstlichen Intelligenz, da es Strom sehr gut leiten kann. Sein Verbrauch wird deshalb in den kommenden Jahren steigen, was zu einer Verknappung und einem Preisboom führen dürfte. (aka)
09:04 Uhr
Freitag, 3. Mai
Kanton Bern bewilligt erste alpine Photovoltaik-Grossanlage
Im Eiltempo hat das Parlament im Herbst 2022 eine Reform durchgepeitscht. Ziel des sogenannten Solarexpress: Bis Ende 2025 sollen zahlreiche neue grosse Solaranlagen in den Alpen ans Netz und damit im Winter für mehr Strom sorgen. Dafür haben National- und Ständerat Umweltauflagen gelockert und zeigen sich bereit, üppige Subventionen zu bezahlen.
Seither sind zahlreiche Projekte für grosse Photovoltaik-Anlagen im Wallis, in Graubünden, in der Ostschweiz und auch im Berner Oberland am Widerstand in Gemeinden oder Alpschaften gescheitert.
Nun meldet der Kanton Bern, dass er eine erste alpine Photovoltaik-Grossanlage bewilligt hat. Das zuständige Regierungsstatthalteramt hat demnach vier gegen das Baugesuch eingereichte Einsprachen abgelehnt. Dies waren von Umweltschutzverbänden gegen das Projekt auf der Alp Morgeten im Simmental eingereicht worden. Es handelt sich damit um eine der ersten Bewilligungen für den Bau einer neuen, grossen alpinen Solaranlage in der Schweiz.
Initiant der Anlage ist der Alpbetreiber mit seiner Morgeten-Solar AG. Diese wiederum wird zu gleichen Teilen finanziert durch einen Solarunternehmer und Grünen-Politiker aus Thun und die Thuner Stadtwerke. Dazu kommen Einzelaktionäre aus der Region.
Die Einsprecher hatten sich wegen Auswirkungen der alpinen Solaranlage auf die Umwelt, den Landschaftsschutz und die Lebensräume der Flora und Fauna gewehrt. Der Kanton kommt nun aber zum Schluss, dass im Fall der geplanten Anlage auf der Alp Morgeten die übergeordneten Interessen des Solarexpress überwiegen.
Die Baubewilligung ist damit zwar fürs Erste erteilt, aber noch nicht rechtskräftig. Der Entscheid kann noch weitergezogen werden. (sat)
07:48 Uhr
Freitag, 3. Mai
Valiant steigert Gewinn im ersten Quartal auf über 30 Millionen Franken
Die Bank Valiant hat den Nettogewinn im ersten Quartal dank eines anhaltend starken Zinsgeschäfts auf 31,7 Millionen Franken gesteigert. Wie die Regiobank am Freitag mitteilt, ist dies ein Plus von knapp 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie das Handelsgeschäft der Valiant Holding warfen in den ersten drei Monaten des Jahres mehr ab. Aus dem Zinsengeschäft resultierte laut Mitteilung ein Brutto-Erfolg von 105,4 Millionen – ein Plus von 9,5 Prozent. Der Netto-Zinserfolg von 100,9 Millionen entspricht dabei einer Steigerung um 11,1 Prozent.
CEO Ewald Burgener freut sich in der Mitteilung «über diesen positiven Jahresstart». Er sieht ihn als Anknüpfung «an das gute Ergebnis von 2023» anknüpfen und als «Beweis dafür, dass unsere Strategie funktioniert». Mit 14 neu eröffneten Geschäftsstellen konnte die lila Bank damals etwa die geografische Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee ein Jahr früher als ursprünglich geplant abschliessen.
Nach dem ersten Quartal hält Valiant überdies an der Prognose fest, 2024 den Konzerngewinn weiter zu steigern. Letztes Jahr hat die Regiobank unter dem Strich 144,3 Millionen erwirtschaftet. (sat)
07:41 Uhr
Freitag, 3. Mai
Schweizer Börse büsst Walliser Kantonalbank mit 80'000 Franken
Die Sanktionskommission der Schweizer Börse (SER) büsst die Walliser Kantonalbank wegen einer Verletzung der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität mit einer Busse von 80’000 Franken. Wie die SER am Freitag in einer Mitteilung schreibt, liegt der Grund für die Busse in einer zu spät erfolgten Publikation des Geschäftsberichts für das Jahr 2022.
Die Börsenaufsicht stuft das Verschulden als «fahrlässig» ein, die Verletzung des Börsenreglements insgesamt als «leicht». Wie die SER schreibt, hat sich die Walliser Kantonalbank nicht gegen die Busse gewehrt, weshalb der Sanktionsbescheid bereits rechtskräftig ist. (sat)
15:04 Uhr
Donnerstag, 2. Mai
SHL Medical setzt Einkaufstour fort
Der laut eigenen Angaben weltweit führende Anbieter für die Medikamentenverabreichung SHL Medical übernimmt den Schweizer Hersteller von Hochleistungs-Spritzgiesswerkzeugen SMC Mould Innovation mit Sitz in Hallau SH. Das gab das seit 2018 in Zug basierte Medtechunternehmen SHL Medical am Donnerstag bekannt.
Der Kauf von SMC Mould Innovation ist nach jenem der Schweizer Firma LCA Automation und des US-Unternehmens Superior Tooling für SHL Medical bereits die dritte Übernahme innerhalb eines Jahres. Die Expansionsstrategie ziele darauf ab, «die steigende Marktnachfrage nach Autoinjektoren zu bedienen, die globale Produktionskapazität auszubauen und die Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette weltweit zu stärken», heisst es bei SHL Medical.
Für die Firma SMC Mould Innovation ändert sich vorerst nichts, heisst es bei SHL Medical. Der Standort sowie alle 25 Mitarbeitenden würden übernommen und als eigenständige Firma weitergeführt. SHL Medical wiederum zählt weltweit über 5700 Mitarbeitende, davon sind rund 200 in der Schweiz.
Derzeit hat das Unternehmen SHL Medical, zu dessen Konkurrenten etwa die Schweizer Firma Ypsomed von Nationalrat Simon Michel gehört, in Zug nur Büro. Bis 2026 soll hier aber auch eine zusätzliche Produktionsstätte aufgebaut werden für die derzeit stark gefragten Autoinjektoren, die unter anderem vom Boom der Fettwegspritzen profitieren. (fv)
14:18 Uhr
Donnerstag, 2. Mai
Huber+Suhner baut neue Fabrik in Polen
Der Technologiekonzern Huber+Suhner mit Sitz in Herisau und Pfäffikon ZH baut in Polen eine neue Produktionsstätte zur Herstellung von Optical Circuit Switches (optische Netzwerkverteiler) der Tochterfirma Polatis. Diese werden benötigt, um effizient grosse Datenmengen mit hoher Bitrate schnell zu vermitteln. Mit diesen Switches lassen sich Kapazitäten in Rechenzentren besser nutzen und Daten in grossen Telekom-Netzwerken besser managen.
Huber+Suhner errichtet das neue Werk mit einer Fläche von 3000 Quadratmetern bis Ende 2024 in Pisary. Es wird die bestehende Polatis-Fabrik in Krzeszowice ersetzen, die an der Kapazitätsgrenze arbeitet. Wie viel investiert Huber+Suhner in die neue Produktionsstätte im Süden Polens? Wie viele Mitarbeitende werden dort beschäftigt sein? Und wie viele Angestellte sind es am aktuellen Standort? Darüber gibt das Unternehmen auch auf Anfrage keine Auskunft und schreibt: «Der neue Standort wird schrittweise entwickelt, und wir geben dazu keine weiteren Details bekannt.»
Huber+Suhner hatte Polatis Mitte 2016 übernommen. Damals beschäftigte das amerikanisch-britische Unternehmen an seinen drei Standorten in Grossbritannien, den USA und in Polen 110 Mitarbeitende und setzte im Jahr 13 Millionen Dollar um. (T.G.)
13:43 Uhr
Donnerstag, 2. Mai
Die Preise sind im April um 0,3 Prozent gestiegen
Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) ist im April 2024 im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen und erreicht damit den Stand von 107,4 Punkten (Dezember 2020 = 100). Das teilte das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mit. Im Vergleich zum April 2023 betrug die Teuerung ganze 1,4 Prozent.
Der Anstieg um 0,3 Prozent im Vergleich zum März 2024 ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie die Bundesstatistiker ausführen. Unter anderem sind die Preise für Pauschalreisen ins Ausland und für den Luftverkehr gestiegen. Ebenfalls teurer wurden Möbel und Einrichtungszubehör. Und auch die Benzinpreise gingen hoch.
Gesunken sind hingegen die Preise für Hotellerie und Parahotellerie, ebenso wie jene für Gas. (fv)
08:12 Uhr
Donnerstag, 2. Mai
Glasfaserstreit: Swisscom zieht Entscheid der Weko weiter
Die Swisscom geht vor Bundesgericht, wie sie am Donnerstag mitteilte: Sie wird die am 25. April veröffentlichte Verfügung der Wettbewerbskommission (Weko) weiterziehen. Für Swisscom seien der Entscheid und die Begründungen der Weko in wesentlichen Punkten nicht nachvollziehbar. Man sei der Ansicht, «sich wettbewerbsrechtlich korrekt verhalten zu haben». Der Weiterzug der Verfügung hat keinen Einfluss auf den Weiterausbau der Glasfaseranschlüsse.
Die Weko hatte vor einer Woche eine Busse von rund 18 Millionen Franken gegen die Swisscom verhängt. Dies, da «Swisscom mit ihrer geänderten Netzbaustrategie Konkurrentinnen den Zugang zum Glasfasernetz verunmöglicht und damit gegen Kartellrecht verstossen hat», wie die Behörde damals mitteilte.
Der Glasfaser-Streit zwischen der Weko und der Swisscom tobt schon länger. Schon kurz nachdem die Swisscom 2020 ihre Strategie geändert hatte, intervenierten die Wettbewerbshüter und untersagten ihr das Vorgehen. «Swisscom hätte sonst die bestehende Marktstruktur verändert und für sich selbst ein faktisches Monopol geschaffen», so die Weko. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie viele Zuleitungen gebaut werden müssen. Die Swisscom plante dabei nur eine Zuleitung. (fv)
07:58 Uhr
Donnerstag, 2. Mai
Der Umsatz bei Sunrise bleibt stabil
Der Telekomanbieter Sunrise erzielte in den Monaten Januar bis März 2024 einen Umsatz von 746,8 Millionen Franken. Das ist ungefähr gleich viel wie in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Rückläufig war der Umsatz mit Privatkunden-Mobilabos und dies aufgrund tieferer Geräteverkäufe sowie einer tieferen Prepaid-Kundenbasis. Zulegen konnte Sunrise bei den Postpaid-Abos. Positiv wirkten sich auch «die Effekte der allgemeinen Preiserhöhung» aus, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab.
Das segmentbereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) stieg im ersten Quartal 2024 leicht gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,4 Prozent und erreichte 244,3 Millionen Franken. (fv)
07:19 Uhr
Donnerstag, 2. Mai
Swisscom macht weniger Umsatz
Die Swisscom erwirtschaftete im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 2,7 Milliarden Franken, das sind 1,6 Prozent weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Noch stärker sank der Umsatz im Schweizer Kerngeschäft: Dieser betrug mit 1,99 Milliarden Franken 2,5 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.
Umsatzmässig zulegen konnte die Swisscom nur beim vergleichsweise kleinen Geschäft mit den IT-Diensten für Geschäftskunden - und in Italien: Das Umsatzwachstum bei Fastweb beträgt - zu stabilen Wechselkursen - im Vergleich zum Vorjahr 5,6 Prozent.
Auch bei der Entwicklung des Betriebsergebnis (Ebitda) sind die Vorzeichen ausser bei beim italienischen Fastweb-Geschäft negativ. Unter dem Strich konnte die Swisscom den Reingewinn im Januar bis März um 2,9 Prozent auf 455 Millionen Franken steigern. (fv)
14:37 Uhr
Dienstag, 30. April
Vorwurf der Vetternwirtschaft: Chef tritt zurück
Beim öffentlichen Genfer Energiedienstleister SIG brodelt es gewaltig. Der Vorwurf gegen den Chef Christian Brunier lautet auf Vetternwirtschaft. Gemäss Enthüllungen der Zeitung «Tribune de Genève» und des Fernsehens Léman Bleu soll er Verwandten, unter anderem seinen beiden Stiefsöhnen, Posten bei der SIG zugeschanzt haben.
Nun nimmt Brunier den Hut, wie der Energiedienstleister gestern mitteilte. Der 61-Jährige geht ein Jahr früher als geplant in den vorzeitigen Ruhestand. Brunier arbeitete 45 Jahre bei SIG, davon zehn Jahre als Chef. Verwaltungsratspräsident Robert Cramer sagte vor den Medien, Brunier habe es «für besser gehalten, so schnell wie möglich zu gehen». Er dankte dem abtretenden Chef für seine Arbeit.
Laut der SIG werden die laufenden Untersuchungen fortgesetzt, «um möglichst vollständige Klarheit über die Kritikpunkte zu schaffen». Man werde etwa das Einstellungsverfahren überprüfen. (aka)
13:00 Uhr
Dienstag, 30. April
Interne Nachfolge beim IT-Konzern Also
Der IT-Grosshändler Also hat eine interne Nachfolgelösung gefunden: Wolfgang Krainz übernimmt per 1. Mai den Chefposten beim in Emmen LU ansässigen, weltweit tätigen Konzern mit über 4000 Mitarbeitenden. Er folgt damit auf Gustavo Möller-Hergt, der die Ämter als CEO und als Verwaltungsratspräsident in Personalunion innehatte. Möller-Hergt bleibt als Verwaltungsratspräsident bei Also, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heisst.
Der neue Chef ist seit 2016 im Unternehmen. Zuletzt leitete er die Bereiche Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Unter ihm soll sich die Firma stärker auf vertriebliche Aspekte ausrichten, um das profitable Wachstum zu beschleunigen, wird Krainz in der Mitteilung zitiert. (aka)
09:45 Uhr
Dienstag, 30. April
McDonald's plant sieben neue Restaurants
Neun neue Standorte hat die US-Fast-Food-Kette McDonald's in den vergangenen zwei Jahren in der Schweiz eröffnet. Und 2024 sollen noch einmal sieben dazukommen, wie der Burger-Brater am Dienstag mitteilt. Die Restaurants sollen in Küssnacht am Rigi, Schaffhausen, Sirnach, Wattwil und Zug entstehen, wie McDonald's auf Nachfrage präzisiert. In Zürich werde bald ein Baugesuch eingereicht, und auch für andere Standorte gebe es Gespräche.
Damit soll es hierzulande mittelfristig 200 Restaurants geben. Man wolle dort sein, wo die Gäste arbeiten und leben, lässt sich Schweiz-Chefin Lara Skripitsky zitieren. Bereits im Herbst kündigte die Kanadierin im Interview mit CH Media ein höheres Expansionstempo an.
Zudem plant McDonald's, Angebote wie den Heimlieferservice McDelivery auszubauen. Immer beliebter werde auch die Bestellung via App: Bereits bei jeder fünften Bestellung sei sie im Einsatz. Mit der sogenannten Order&Pay-Funktion verkürze sich die Wartezeit im Restaurant; die Gäste könnten schon von unterwegs bestellen und direkt am Tisch Platz nehmen. (aka/mim)
07:45 Uhr
Dienstag, 30. April
Clariant: weniger Umsatz, aber höhere Profitabilität
Das Chemieunternehmen Clariant erzielte im ersten Quartal 6 Prozent weniger Umsatz als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Er belief sich auf 1,01 Milliarden Franken.
Die Wechselkurse machten dem Spezialchemiekonzern zu schaffen. In lokaler Währung gerechnet sei der Umsatz lediglich um 11 Prozent zurückgegangen, heisst es in einer Mitteilung.
Gleichzeitig konnte die Gewinnmarge von 13,9 auf 17,1 Prozent gesteigert werden. Der Betriebsgewinn (Ebitda) stieg im ersten Quartal um 4 Prozent auf 173 Millionen Franken. Im gleichen Zeitraum waren es im Jahr 2023 167 Millionen Franken gewesen. (rit)
07:13 Uhr
Dienstag, 30. April
Fluggesellschaft Swiss startet schwach ins Jahr und jammert über teures Personal
Die Fluggesellschaft Swiss ist mit einem schwächeren operativen Ergebnis ins Jahr 2024 gestartet als im Jahr davor. Im ersten Quartal waren es 30,7 Millionen Franken. Das sind 48 Millionen Franken weniger als im Jahr 2023. Die Lufthansa-Tochter führt dies auf «niedrigere Durchschnittserlöse, ein schwächeres Frachtgeschäft sowie gestiegene Kosten, insbesondere im Personalbereich» zurück.
Offenbar ist der Reise-Boom, der nach der Corona-Pause einsetzte, ins Stocken geraten. «Die aussergewöhnlichen Marktbedingungen, die die Branche in der unmittelbaren Zeit nach der Pandemie geprägt haben», hätten sich «weiter aufgelöst», lässt sich Markus Binkert, Finanzchef von Swiss, in einer Mitteilung zitieren.
Als Erklärung für den schlechten Start verweist Swiss auf die eigenen Mitarbeiter. So hätten sich «vor allem höhere Personalkosten als Folge der neu verhandelten Gesamtarbeitsverträge für die Mitarbeitenden im Cockpit und in der Kabine» belastend auf das Ergebnis ausgewirkt. (rit)
10:30 Uhr
Montag, 29. April
SGB: Reallöhne zum dritten Mal in Folge gesunken
Es droht ein «verlorenes Jahrzehnt» bei den Löhnen: Mit diesen Worten warnt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) vor dem Kaufkraftverlust vor allem bei tiefen und mittleren Einkommen. Die Reallöhne seien heute nicht wesentlich höher als im Jahr 2016, heisst es im Verteilungsbericht 2024, den der SGB am Montag publiziert hat.
In den vergangenen drei Jahren seien die Reallöhne sogar gesunken, erklärte SGB-Chefökonom Daniel Lampart an einer Medienkonferenz: «Das gab es seit dem zweiten Weltkrieg, seit wir solche Statistiken haben, noch nie.» Als Hauptgrund dafür benennt Lampart ein «neues Verhalten der Arbeitgeber».
Früher sei der Teuerungsausgleich in der Schweizer Sozialpartnerschaft selbstverständlich gewesen. Bis 2016 seien die Reallöhne ungefähr im gleichen Mass wie die Produktivität gestiegen. Heute würden viele Firmen ihrer Kundschaft zwar höhere Preise verrechnen, sie seien aber nicht bereit, ihren Angestellten einen Teuerungsausgleich zu gewähren. Das negative Paradebeispiel dafür sei die Baubranche. Dort seien die Arbeitgeber zu gar keiner Lohnerhöhung bereit gewesen.
Das wirkt sich laut Lampart «sehr zu Ungunsten der Löhne» aus. Es brauche nun spürbare Reallohnerhöhungen, um die Lohnlücke zu schliessen. Zumal die Belastung durch die steigenden Krankenkassenprämien für viele Normalverdienende «untragbar» geworden sei.
Demgegenüber stellt der SGB bei den Bestverdienenden eine gegenläufige Tendenz fest. Das bestbezahlte Prozent habe den Reallohn um über 3000 Franken pro Monat steigern können. Einer der Haupttreiber dieser Entwicklung ist laut dem SGB, dass der Teuerungsausgleich für alle durch mehr individuelle Lohnerhöhungen ersetzt worden sei. Davon würden vor allem die Top-Verdienenden profitieren – insbesondere über Bonuszahlungen und variable Lohnkomponenten.
So steige auch die Zahl der sogenannten Lohnmillionäre rasant. Die Zahl der Menschen, die pro Jahr über eine Million Franken kassieren, habe sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Laut den Daten des SGB gab es 2021 in der Schweiz über 4000 Lohnmillionäre. Auf 17’000 beziffern die Gewerkschafter die Zahl jener, die mindestens eine halbe Million Franken jährlich verdienen. (aka)
09:35 Uhr
Montag, 29. April
Swiss Steel: Die neuen Mitglieder im Verwaltungsrat
Die Swiss Steel Holding AG hat am Montag die Nominierungen für die Wahl in den Verwaltungsrat bekannt gegeben. Der Generalversammlung vom 23. Mai werden Alexander Gut, Karl Haider und Martin Lindqvist als neue Mitglieder vorgeschlagen. Jens Alder wird vorerst als Präsident nominiert, aber nur bis zum Eintritt von Lindqvist spätestens am 1. Oktober. Dann soll Lindqvist zum Präsidenten nominiert werden. Nicht zur Wiederwahl steht Emese Weissenbacher.
Ausserdem schlägt der Verwaltungsrat eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 200:1 vor, um den Nennwert pro Aktie zu erhöhen. Das soll die Aktien der Gesellschaft für einen breiteren Anlegerkreis attraktiv machen. Jeder Inhaber von jeweils 200 Namenaktien mit einem Nennwert von 0.08 Franken soll eine neue Namenaktie mit einem Nennwert von 16 Franken erhalten.
Swiss Steel steckt in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Erst Anfang Monat wurde eine ausserordentliche Kapitalerhöhung von rund 300 Millionen Euro beschlossen, mit dem der Konzern saniert werden soll. Möglich ist diese, weil Hauptaktionär und Amag-Erbe Martin Haefner bereit ist, sie mitzutragen – anders als Aktionär Peter Spuhler, dem der Zugbauer Stadler Rail gehört und der nun bei Swiss Steel aussteigen will. (ehs)
14:09 Uhr
Freitag, 26. April
Mutterkonzern will Tiktok lieber dichtmachen als verkaufen
Der Videoplattform Tiktok droht in den USA ein Verbot. Das US-Parlament hat dem chinesischen Mutterkonzern Bytedance ein Ultimatum gestellt: Innert eines Jahres muss sie das US-Geschäft an einen neuen Besitzer verkaufen, welcher der Regierung genehm ist. Ansonsten soll die populäre App, die von 170 Millionen Amerikanern genutzt wird, verboten werden.
Doch dabei will die jetzige Besitzerin nicht mitmachen. Bytedance hat bereits angekündigt, gegen den Beschluss vor Gericht zu ziehen. Aber mehr noch: Sollte sie damit nicht erfolgreich sein, würde Bytedance Tiktok lieber dichtmachen, als es zu verkaufen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier Quellen, die dem Mutterkonzern nahestehen.
Der Algorithmus ist für den Konzern zu wertvoll
Die Algorithmen, mit denen Tiktok funktioniert, seien für das Geschäft von Bytedance zentral. Dies mache einen Verkauf der App «höchst unwahrscheinlich», da der Konzern seinen Kernalgorithmus nicht aufgeben wolle, so die Quellen. Demgegenüber wären die Folgen einer Schliessung viel geringer. Denn auf Tiktok entfallen nur ein kleiner Teil der Gesamteinnahmen und der täglich aktiven Nutzer von Bytedance. Andere Apps, die es nur in China gibt, sorgen für einen Grossteil des Umsatzes.
Die Tiktok-Besitzerin lehnte eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab. Sie verwies nur auf Statements, wonach es keine Pläne gebe, das Social-Media-Unternehmen zu verkaufen. Zugleich haben laut Berichten schon US-Investoren ein Kaufinteresse bekundet.
Ob der Beschluss des US-Parlaments überhaupt rechtens ist, müssen nun Gerichte entscheiden. Tiktok-Chef Shou Zi Chew sagte am Mittwoch, man rechne damit, eine Anfechtungsklage zu gewinnen, um die Gesetzgebung zu blockieren. Tiktok wird vor Gericht argumentieren, sie verstosse gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung.
Verdacht auf Spionage – China wehrt sich
Die USA dagegen sehen in der Kurzvideo-App eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Dies soll mit dem von Präsident Joe Biden unterzeichneten Gesetz unterbunden werden. Es herrscht die Sorge, dass Bytedance unter Kontrolle der chinesischen Regierung stehe. So könnte China auf die Daten der Amerikaner zugreifen oder die App zur Überwachung nutzen.
Bytedance weist dies zwar scharf zurück. Doch die chinesische Regierung wehrt sich gegen den Zwangsverkauf und sagte bereits, man werde sich dem «entschieden widersetzen». Ein allfälliger Verkauf von Tiktok beinhalte den Export von Technologie und müsste deshalb offiziell genehmigt werden. (aka)
10:58 Uhr
Freitag, 26. April
Axpo eröffnet grösste Produktionsanlage für grünen Wasserstoff
Seit drei Jahren werden überall in der Schweiz Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff gebaut. Dies, nachdem kurz davor Hyundai im Verkehrshaus in Luzern den ersten wasserstoffbetriebenen Lastwagen der Welt präsentiert hatte.
Neuester Streich: In Graubünden ist am Freitag die bislang grösste Produktionsanlage in Betrieb genommen worden. Die 2,5-Megawatt-Anlage soll jährlich bis zu 350 Tonnen Wasserstoff produzieren und liegt direkt neben dem Kraftwerk Reichenau in Domat/Ems. Das schreiben der Energiekonzern Axpo und das lokale Werk Rhiienergie in einer gemeinsamen Mitteilung.
Mit dem produzierten Wasserstoff können laut den Betreibern jährlich bis zu 1,5 Millionen Liter Diesel eingespart werden. Die Produktion von grünem Wasserstoff erfolgt dabei durch Wasserelektrolyse, bei welcher der «grüne» Strom direkt aus dem Wasserkraftwerk nebenan verwendet werden kann. «Die Produktion ist damit CO 2 -neutral», schreiben Axpo und Rhiienergie.
Der Wasserstoff soll vor Ort verdichtet werden, damit er künftig einfach zu Tankstellen und Industriekunden geliefert werden kann. «Es gibt noch ein paar Hürden zu meistern», wird Axpo-CEO Christoph Brand in der Mitteilung zitiert. Sein Energieunternehmen sei jedoch «vom Potenzial des grünen, nachhaltigen und erneuerbaren Energieträgers überzeugt». (sat)
06:37 Uhr
Freitag, 26. April
Happige Busse für Schoggihersteller Barry Callebaut
Barry Callebaut erhält eine Busse aufgebrummt. Die Sanktionskommission der Schweizer Börse (SER) hat gegen den in der Schweiz beheimateten, weltweit tätigen Schoggihersteller eine Busse von 110’000 Franken verhängt. Grund: Eine schwere, fahrlässige Verletzung der Vorschriften zur Publikation von börsenrelevanten Informationen, wie die SER am Freitag in einer Mitteilung schreibt.
Nach Abschluss eines umfassenden Untersuchungsverfahrens habe SER den entsprechenden Sanktionsantrag zum Entscheid der Schweizer Börse überwiesen. Dieser sei von der SIX Group AG genehmigt und in der Folge von Barry Callebaut akzeptiert worden und darum inzwischen bereits rechtskräftig.
Hintergrund des Falls ist laut SER die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2021/22, welcher vor dem eigentlichen Publikationszeitpunkt während der handelskritischen Zeit für einen Webcrawler bereits online abrufbar war. (sat)
06:11 Uhr
Freitag, 26. April
Dank KI: Google und Microsoft mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn
Google verdient Milliarden mit Werbung in seiner Suchmaschine. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf knapp 62 Milliarden Dollar. Die Videotochter YouTube steuerte dazu gut acht Milliarden bei – rund 21 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.
Die Entwicklung von Googles Werbegeschäft – vor allem in der Websuche als wichtigstem Geldbringer – wird sehr genau beobachtet. Eine zentrale Frage ist, ob Versuche von Konkurrenten, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) direkte Antworten statt Links anzuzeigen, eine Spur bei der seit Jahren dominierenden Suchmaschine hinterlassen.
Bei der Google-Mutter Alphabet insgesamt stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf gut 80 Milliarden. Analysten hatten im Schnitt mit leicht weniger gerechnet. Der Konzerngewinn wuchs auf knapp 24 Milliarden (Vorjahr: gut 15 Milliarden).
Auch der Rivale Microsoft gab ein klares Signal, dass sich seine Investitionen in Cloud und Künstliche Intelligenz auszahlen. Der Software-Riese schloss einen Pakt mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und integriert auf dieser Basis KI-Funktionen in immer mehr seiner Produkte. Der Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz treibt wiederum Microsofts Cloud-Geschäft an.
Microsoft steigerte den Umsatz im Ende März abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 62 Milliarden Dollar. Der Gewinn wuchs um ein Fünftel auf fast 22 Milliarden. Beides übertraf die Erwartungen von Experten.
Bei Alphabet stieg der Umsatz der sogenannten «anderen Wetten» – Zukunftsprojekte wie selbstfahrende Autos oder Lieferdrohnen – insgesamt von 288 auf 495 Millionen Dollar. Der operative Verlust der Sparte wurde gedrückt, von 1,22 Milliarden vor einem Jahr auf jetzt gut eine Milliarde Dollar. (dpa/sat)
14:34 Uhr
Donnerstag, 25. April
Greenwashing-Vorwurf: Strafanzeige gegen Heli-Anbieter
Der Konsumentenschutz wehrt sich gegen irreführende Umwelt-Werbung, sogenanntes Greenwashing. Letzten Sommer bemängelte er die Werbeversprechen von acht Unternehmen. Mittlerweile haben sechs ihre Aussagen korrigiert. Während die Swisscom eine Anpassung in Aussicht stellt, wirbt der Helikopterflug-Anbieter Elite Flights weiter mit «umweltfreundlichen Flügen». Der Konsumentenschutz reicht deshalb Strafanzeige ein. (mpa)
11:11 Uhr
Donnerstag, 25. April
Nestlé enttäuscht mit neusten Zahlen
Der Westschweizer Nahrungsmittelmulti ist gleich mit zwei zünftigen Skandalen konfrontiert. Da wäre die illegale Mineralwasser-Behandlung bei mehreren Marken inklusive Henniez. Und dann die Tatsache, dass Nestlé Babynahrung in ärmeren Ländern mit Zucker versetzt – im Gegensatz zu Europa.
Und nun legt der von Mark Schneider geführte Konzern auch noch enttäuschende Quartalszahlen vor. Der Umsatz mit Produkten wie Nescafé, Kitkat oder San Pellegrino sank in den ersten drei Monaten des Jahres um 5,9 Prozent auf 22,1 Milliarden Franken. Wechselkurseffekte schmälerten den Umsatz um 6,7 Prozent.
Das organische Wachstum stieg zwar unter dem Strich um 1,4 Prozent, allerdings wurde insgesamt weniger abgesetzt, da allein die Preisanpassungen 3,4 Prozent ausmachten. Sogar die Resultate bei den eigentlichen Erfolgsgaranten, der Kaffeemarke Nespresso und der Tierfuttermarke Purina, enttäuschten.
Laut ZKB-Analyst Patrik Schwendimann fiel das organische Wachstum, das so genannte Real Internal Growth (RIG), noch negativer aus als befürchtet. Die Investorenstimmung gegenüber Nestlé sei in den vergangenen 25 Jahren nie so schlecht gewesen. Der Konzern müsse in den kommenden Quartalen klare Verbesserungen zeigen. Und Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy verweist auf die beiden Skandale, welche den Investoren Sorgen bereiteten. Es brauche Massnahmen, um die Organisation neu zu beleben.
Nestlé selbst rechnet für das Gesamtjahr mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 4 Prozent. (bwe)
07:31 Uhr
DONNERSTAG, 25. APRIL
Wegen Glasfasernetz: Swisscom muss Millionen-Busse bezahlen
Die Wettbewerbskommission (Weko) verhängt eine happige Busse gegen die Swisscom. Rund 18 Millionen Franken muss der Telekommunikationskonzern bezahlen. Dies, da «Swisscom mit ihrer geänderten Netzbaustrategie Konkurrentinnen den Zugang zum Glasfasernetz verunmöglicht und damit gegen Kartellrecht verstossen hat», wie die Weko am Donnerstag schreibt.
Der Streit zwischen Weko und Swisscom tobt schon länger. Schon kurz nach der Änderung ihrer Strategie 2020 hatten die Wettbewerbshüter interveniert und der Swisscom das Vorgehen untersagt. «Swisscom hätte sonst die bestehende Marktstruktur verändert und für sich selbst ein faktisches Monopol geschaffen», so die Weko. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie viele Zuleitungen gebaut werden müssen. Die Swisscom plante dabei nur eine Zuleitung.
Ob Swisscom die Busse tatsächlich bezahlen muss, ist offen. Noch kann der Konzern den Fall bis zum Bundesverwaltungsgericht weiterziehen. Diesen Schritt behalte man sich vor, schreibt die Swisscom. Zudem wirft sie der Weko vor, dass mit diesem Entscheid der rasche Netzausbau verzögert und verteuert werde.
«Swisscom ist der Ansicht, sich wettbewerbsrechtlich korrekt verhalten zu haben», schreibt das Unternehmen. Auch mit ihrer Ausbauvariante hätten alle Mitbewerber «nichtdiskriminierend einen Datenstrom zu einem bestimmten Anschluss beziehen können». (mg)
07:18 Uhr
DONNERSTAG, 25. APRIL
Nationalbank macht fast 60 Milliarden Franken Gewinn
Von Januar bis März kann die Schweizerische Nationalbank (SNB) einen Gewinn von 58,8 Milliarden Franken ausweisen. Damit wurde im Vorfeld gerechnet, Grund ist die Frankenschwäche. So erzielte die SNB alleine auf den Fremdwährungspositionen einen Gewinn vom 52,4 Milliarden. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 8,9 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Ob sich deswegen die Kantone auf Ausschüttungen aus den SNB-Gewinnen freuen können, bleibt weiterhin ungewiss. Das Ergebnis der Nationalbank sei «überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen und Kapitalmärkte abhängig». Starke Schwankungen seien «deshalb die Regel und Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich», schreibt die Nationalbank.
Ob Gelder ausgeschüttet werden, entscheidet sich erst Ende Jahr. (mg)
06:46 Uhr
DONNERSTAG, 25. APRIL
Deutlicher Umsatzrückgang bei Ems-Chemie
Das erste Quartal des laufenden Jahres ist für den Spezialchemiekonzern Ems-Chemie zäh verlaufen. Der Umsatz sank um 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Gesamthaft setzte die Ems-Gruppe 545 Millionen Franken um, 2023 waren es noch 614 Millionen. Gründe dafür seien die «verhaltene Konjunktur», die «gedrückte Konsumentenstimmung in Europa und China» und die «ansteigenden Energie-, Rohstoff- und Frachtkosten».
Wie Ems am Donnerstag schreibt, würden gerade die steigenden Kosten Preiserhöhungen «unumgänglich» machen. Trotz dem gedämpften Start ins Jahr bleibt der Konzern für das gesamte Jahr zuversichtlich. Ems erwarte «unverändert einen Nettoumsatz auf Vorjahreshöhe und ein Betriebsergebnis leicht über Vorjahr», heisst es in der Mitteilung. Dies unter anderem dank einer «Verkaufsoffensive». Ganz generell sieht sich die Firma «in einer guten Verfassung, die zahlreichen Chancen in den Märkten mittels Innovationen zu erschliessen und dadurch überproportionales Wachstum zu generieren». (mg)
06:26 Uhr
Donnerstag, 25. April
Grosser Rückenwind für Einheitskasse – aber nicht um jeden Preis
Rund 71 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer würden derzeit eine Einheitskasse unterstützen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Comparis. Allerdings: Den Systemwechsel würden die Befragten nur unterstützen, wenn dadurch die monatlichen Prämien um mindestens 40 Franken sinken würden.
Das sei unrealistisch, schreibt der Vergleichsdienst in einer Mitteilung. Lediglich «5 Prozent der Prämien sind Verwaltungskosten der Krankenkassen», so Comparis. Wolle die Schweizer Bevölkerung tatsächlich sinkende Prämien, so gehe dies nur über den Verzicht. «Es ist verlockend, die Schuld für die steigenden Kosten und Prämien den Chefs der Spitäler, Krankenkassen oder der Pharmaindustrie zu geben, aber gleichzeitig zu verlangen, dass immer mehr und immer bessere Medizin weniger kosten soll», schreibt Comparis. (mg)
16:18 Uhr
Mittwoch, 24. April
Washington will Putin-Milliarden beschlagnahmen
Staatliche russische Vermögenswerte, die seit Beginn des Ukraine-Krieges in den USA blockiert sind, dürfen nun von der amerikanischen Regierung konfisziert und veräussert werden. Das hat nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat beschlossen. Die Erlöse aus diesen Zwangsverkäufen, die Einnahmen von bis zu 8 Milliarden Dollar generieren könnten, sollen der Regierung in Kiew überwiesen werden.
In einer ersten Reaktion sprach Finanzministerin Janet Yellen von einem «wichtigen Schritt», wohl auch, weil die USA nun rechtliches Neuland betreten. Yellen deutete an, dass Washington nun Druck auf Verbündete in Europa und Asien ausüben werde. Aktuell sieht es aber nicht danach aus, als ob weitere Staaten grünes Licht für die Konfiskation von blockierten Geldern der russischen Staatsbank geben werden. Die EU zögert, weil sie Angst vor einem Vertrauensverlust in den europäischen Finanzplatz hat. Auch die Schweiz, wo gegenwärtig 7,2 Milliarden Franken an Vermögenswerten der russischen Zentralbank blockiert sind, hat es nicht eilig. Bundesrätin Karin Keller-Sutter sagte vor einigen Tagen während eines Besuchs in Washington, dass diese Vorlage vor allem von den USA forciert werde. Bei den restlichen Mitgliedern der G7 stosse das Vorgehen Washingtons auf Widerstand. (rr)
08:11 Uhr
Mittwoch, 24. April
Börsenneuling Galderma startet mit Rekordumsatz ins neue Jahr
Galderma ist mit einem Rekordumsatz ins neue Jahr gestartet. Wie der Schweizer Crèmen-Hersteller am Mittwoch mitteilt, kletterte der Nettoumsatz in den ersten drei Monaten des Jahres auf 1071 Millionen US-Dollar und damit erstmals über die Milliarden-Grenze. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 12,4 Prozent.
Das Unternehmen, das eben an die Schweizer Börse ging, führt das Umsatz-Plus auf ein «breit abgestütztes Wachstum in allen Produktkategorien» und Weltregionen zurück. Namentlich in den USA habe sich das Wachstum jedoch überdurchschnittlich beschleunigt.
Was dem Hersteller von Daylong & Co. unter dem Strich bleibt, dazu äussert sich Galderma in der Mitteilung zu den Verkaufszahlen nicht. Allerdings hält der Börsenneuling fest, dass er aufgrund der Entwicklung des Umsatz an den bereits geäusserten Zielen für das laufende Jahr festhält - namentlich am Nettoumsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent. (sat)
07:47 Uhr
Mittwoch, 24. April
Roche startet mit Umsatz-Minus ins 2024 – zeigt sich aber optimistisch
Roche hat im ersten Quartal deutlich Umsatz eingebüsst. Wie der Basler Pharma-Konzern am Mittwoch mitteilt, gingen die Verkaufserlöse in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 6 Prozent auf 14,4 Milliarden Franken zurück. In Lokalwährungen verbuchte der Konzern dagegen ein Plus von zwei Prozent.
Zurückzuführen ist dieses satte Minus in Dollar namentlich auf den Rückgang an Covid-19-Produkte. Künftig sollen diese allerdings «keine wesentlichen Auswirkungen mehr auf Verkäufe» haben, schreibt Roche.
Dennoch zeigt sich Thomas Schinecker optimistisch: «Wir sind erfolgreich in dieses Jahr gestartet», lässt sich der Roche-CEO zitieren. Das Basisgeschäft der beiden Divisionen Pharma und Diagnostics habe nämlich «ein hohes einstelliges Wachstum» erzielt. Nach dem Wegfall der Covid-Verkäufe werde die deutliche Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen die in Franken ausgewiesenen Verkäufe des Konzerns im Vergleich zur Vorjahresperiode jedoch weiterhin beeinflusst.
«Wir gehen davon aus, dass unsere Konzernverkäufe dieses Jahr währungsbereinigt im mittleren einstelligen Bereich wachsen werden», blickt CEO Schinecker voraus. Damit könne Roche auch seinen bisherigen Ausblick für 2024 bestätigen.
Den Covid-19-Produkte-Rückgang konnte Roche «dank starker Nachfrage nach neueren Medikamenten sowie Immundiagnostika, klinisch-chemischen Tests und Advanced-Staining-Lösungen» einigermassen wettmachen. Ohne diese Produkte stiegen die Konzernverkäufe nämlich um 7 Prozent - in der Pharmasparte auf 10,9 Milliarden und in der Diagnostics-Sparte auf 3,5 Milliarden.
Nach Regionen betrachtet ist Roche im ersten Quartal insbesondere in Japan unter Druck geraten. Dort brachen die Pharma-Verkäufe um 53 Prozent ein während sie in Europa um 6 Prozent zulegten. ( sat )
13:43 Uhr
Dienstag, 23. April
Für Swisscom-Kunden wird es teurer
Noch letzten August hatte die Swisscom versichert, sie werde bis Ende 2024 die Preise für die Internet-, TV- und Festnetz-Abos nicht erhöhen. Trotzdem wird es für gewisse Swisscom-Kunden ab Juli teurer. Der Grund: Das Unternehmen nimmt drei Produkte definitiv vom Markt. Diese wurden zwar schon länger nicht mehr angeboten. Allerdings konnten bisherige Kunden die Abos weiterhin nutzen.
Damit ist nun Schluss. Konkret kippt der Telekomanbieter die Abos «blue TV S», «blue Internet S» und «Multiroom» aus dem Sortiment. Bestehende Kunden werden auf aktuelle Tarife migriert – und das ist mit höheren Kosten verbunden. Die Differenz beträgt monatlich zwischen 5 und 10 Franken, wie Swisscom-Sprecherin Annina Merk auf Anfrage mitteilt. Sie bestätigt einen Bericht der SRF-Sendung «Espresso».
Merk gibt zu bedenken, dass es sich nicht um Preiserhöhungen handle. Die Produkte enthielten mehr Leistung. «Bei Blue TV S profitieren die Kunden neu von 150 Sender statt 100 Sener plus Replay TV und beim Internet Abo gibt es deutlich mehr Bandbreite. So bietet das Abo neu 100 statt nur 40 Mbit/s.»
Wie viele Kunden betroffen sind, will das Unternehmen auf Nachfrage nicht preisgeben. «Espresso» geht von mehreren Tausend aus. Sicher ist: Der Ärger dürfte bei manchen gross sein. (rwa)
09:41 Uhr
Dienstag, 23. April
14,4 Millionen für Ermotti: UBS habe «jegliches Mass verloren»
UBS-Chef Sergio Ermotti löste Ende März einen Sturm aus, als sein hohes Salär bekannt wurde. Für neun Monate Arbeit erhielt er letztes Jahr 14,4 Millionen Franken. Politiker aus allen Lagern kritisieren den Bank-Manager. Vor der morgigen Generalversammlung der UBS setzt es nun auch geharnischte Worte der Aktionärinnen und Aktionäre ab. Die Schweizer Aktionärsgruppe Actares bezeichnet Ermottis Gehalt als «Affront» gegenüber den Schweizer Aktionärinnen und Aktionären, der Regierung und dem Schweizer Finanzsystem.
«Bei der CEO-Vergütung ging aber jegliches Mass verloren - eine krasse Fehlleistung, die schmerzlich an vergangene CS-Sünden erinnert», heisst es in einer am Dienstag publizierten Mitteilung. Das Salär sprenge «den hier üblichen Rahmen» und sei «masslos übertrieben». Ermotti hätte den Verwaltungsräten mit mehrheitlich angelsächsischem Werdegang einen Hinweis geben müssen. «Mässigung und etwas Demut wäre angebracht - stattdessen ging Vertrauen, viel Vertrauen, verloren.» Actares empfiehlt deshalb den Aktionären, den Vergütungsbericht abzulehnen. (rwa)
09:06 Uhr
Dienstag, 23. April
Wert der blockierten russischen Gelder ist gesunken
Die Schweiz hat 5,8 Milliarden Franken an russischen Vermögen gesperrt. Damit ist der Wert der gesperrten Gelder gegenüber Dezember 2022 um 1,7 Milliarden Franken gesunken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag bekannt gab. Der Rückgang ist vor allem auf den Wertverlust von Wertschriften wie Aktien zurückzuführen. Nur unwesentlich verändert haben sich die gesperrten Gelder der russischen Zentralbank. Sie betragen aktuell 7,24 Milliarden Franken.
Dank eigenen Ermittlungen konnte das Seco weitere Vermögenswerte in der Höhe von 580 Millionen Franken sperren. Auch hat der Bund zwei zusätzliche Liegenschaften blockiert. Neu sind es damit 17 Gebäude. Gesperrt sind hierzulande auch Sport- und Luxusfahrzeuge, Kunstwerke, Mäbel und Instrumente sanktionierter natürlicher Personen, Unternehmen und Organisationen. Insgesamt hat die Schweiz 1703 Personen und 421 Gesellschaften sanktioniert. (rwa)
07:02 Uhr
Dienstag, 23. April
Novartis legt im ersten Quartal deutlich zu
Novartis blickt auf ein gutes erstes Quartal zurück: Der Nettoumsatz wuchs zu konstanten Wechselkursen um 11 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte. Treiber waren unter anderem das Herzmedikament Entresto sowie das Schuppenflechtenmittel Cosentyx. Der Reingewinn belief sich auf 2,7 Milliarden Dollar – ein Plus von 37 Prozent. Angesichts des guten Starts ins neue Geschäftsjahr hebt die Prognose für 2024 an. Der Konzern erwartet beim Nettoumsatz einen Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Auch personell stehen die Zeichen auf Veränderung. Der Verwaltungsrat schlägt Giovanni Caforio als Präsident des Verwaltungsrates vor. Er soll auf Jörg Reinhardt folgen, dessen 12-jährige Amtszeit planmässig im Jahr 2025 endet, wenn er in die Pension geht. (rwa)
06:50 Uhr
Dienstag, 23. April
Harziger Start für Kühne+Nagel ins neue Jahr
Der Start ins neue Geschäftsjahr ist dem Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel mässig geglückt. Im ersten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5,5 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Minus von 18 Prozent, wie es in einer Mitteilung heisst. Rückläufig war auch der Gewinn, der um satte 40 Prozent von 462 Millionen auf 278 Millionen Franken sank.
Laut Angaben des Unternehmens war das Ergebnis in den ersten drei Monaten des Jahres durch deutliche negative Wechselkurseffekte von 3 Prozent beeinflusst. Trotzdem zeigt sich die Konzernspitze zuversichtlich. «Kühne+Nagel hat den Jahresauftakt 2024 in einem anspruchsvollen Umfeld solide, jedoch mit rückläufigen Ergebnissen, abgeschlossen», lässt sich CEO Stefan Paul in der Mitteilung zitieren. (rwa)
19:27 Uhr
Montag, 22. April
Die Nationalbank bittet die Banken zur Kasse
Nationalbank Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet die 210 Geschäftsbanken in der Schweiz ab Anfang Juli dazu, die Mindestreserve auf den bei ihr gehaltenen Sichtguthaben von 2,5 Prozent auf das gesetzliche Maximum von 4 Prozent zu erhöhen. Weil die Nationalbank auf die Mindestreserven der Geschäftsbanken seit Dezember 2023 keinen Zins mehr entrichtet, entgehen diesen Einnahmen in ein dreistelliger Millionenhöhe. Zudem hat die Nationalbank enschieden, gewisse Ausnahmen, die zur Berechnung der Mindestreservehaltung gelten, zum gleichen Zeitpunkt aufzuheben. Konkret geht es um kündbare Einlagen von Geschäftsbankkunden, die neu vollständig in die Berechnung des Mindestreserveerfordernisses einfliessen.
Alles in allem entgehen den Geschäftsbanken damit Zinseinnahmen in Höhe von rund 400 Millionen Franken. Schon die Aufhebung der Verzinsung der Mindestreserve im Dezember hatte die Banken um Zinseinnahmen von rund 200 Millionen Franken erleichtert. Umgekehrt erwächst der Nationalbank unter Einschluss der damaligen Massnahme ein zusätzlicher Zinsertrag in Höhe von 600 Millionen Franken pro Jahr. Die Geschäftsbanken können diesen Ertragsausfall leicht verkraften. 2023 haben sie im Zinsengeschäft gut verdient, nicht zuletzt, weil sie mit der Weitergabe der von der Nationalbank 2022 eingeleiteten Erhöhung des Zinsniveaus nur zögerlich vorangegangen sind. Aktuell beläuft sich der Leitzins auf 1,5 Prozent. Standardkonti werden gemäss dem Vergleichsdienst Moneyland mit durchschnittlich 0,81 Prozent verzinst. UBS, CS und die Migrosbank offerieren eine Verzinsung von 0,75 Prozent. (dz)
06:42 Uhr
Freitag, 19. April
Börsenaufsicht büsst Aevis Victoria mit 30'000 Franken
Die Aufsicht der Schweizer Börse (SIX) büsst die Schweizer Kliniken- und Hotelgruppe Aevis Victoria AG mit 30'000 Franken. Grund für die Busse ist «ein Fehler bei der Verbreitung einer Ad hoc-Mitteilung, nicht deren Inhalt», wie die Sanktionskommission (SER) am Freitag in einer Mitteilung schreibt.
Konkret ist eine potenziell kursrelevante Information von Aevis Victoria zu spät per Mail versandt worden. Das Verschulden bezeichnet die Börsenaufsicht «als fahrlässig» und die Verletzung der Börsenregeln «insgesamt als ernsthaft».
Der Busse voraus ging laut SER ein Untersuchungsverfahren. In dessen Verlauf habe sich Aevis Victoria zwar versucht, gegen den Entscheid zu wehren. Doch sei die entsprechende Beschwerde bereits am 13. Februar 2024 abgewiesen worden. Nachdem die Unternehmensgruppe auf weitere Rechtsmittel verzichtete, sei die Busse nun in Kraft getreten. (sat)
06:12 Uhr
Freitag, 19. April
Bundesgericht hebt Millionen-Busse gegen Swisscom auf
Die Swisscom hat das Kartellrecht doch nicht verletzt: Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht und gibt damit in letzter Instanz einer Beschwerde des grössten Telekommunikationsunternehmens des Landes Recht. Die siegreiche Swisscom begrüsst den Entscheid der Lausanner Richter.
Die Wettbewerbskommission (Weko) war 2015 zum Schluss gekommen, die Swisscom habe in einem Fall aus dem Jahr 2008 wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gegen das Kartellgesetz verstossen. Dafür verhängten die Wettbewerbshüter eine Busse von 7,9 Millionen Franken. In der Folge bestätigte auch das Bundesverwaltungsgericht diese Sanktion, senkte die Busse aber auf 7,5 Millionen.
Das höchste Gericht im Land kommt nun zu einem anderen Schluss. Zwar habe Swisscom «auf den relevanten Märkten über eine marktbeherrschende Stellung verfügt», schreibt das Bundesgericht am Freitag in einer Mitteilung. «Allerdings hat Swisscom weder gegenüber Sunrise noch gegenüber der Post unangemessene Preise erzwungen.»
Hintergrund des Falls ist eine Ausschreibung der Schweizerischen Post zur Errichtung und zum Betrieb eines Breitbandnetzes für ihre 2300 Standorte im ganzen Land. Die Swisscom erhielt damals den Zuschlag. Dagegen reichte die unterlegene Sunrise bei der Weko Anzeige ein.
Entsprechend erfreut reagierte die Swisscom bereits am Donnerstag in einer Mitteilung zum letztinstanzlichen Entscheid des Bundesgerichts. Dieser zeige, dass das Unternehmen «weder gegenüber Sunrise noch gegenüber der Post unangemessene Preise erzwungen und sich bei der Festlegung der Preise für Vorleistungsprodukte korrekt verhalten» habe, so das Telekommunikationsunternehmen. (sat)
15:53 Uhr
Donnerstag, 18. April
Konsum bleibt stabil
Die Konsumtätigkeit der Haushalte macht etwa die Hälfte der Schweizer Wirtschaftstätigkeit aus. Laut neuen Daten des Postfinance-Konsumindikators, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigt sich trotz «äusserst pessimistischer» Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten kein Einbruch beim Konsum.
Kalenderbereinigt seien die Ausgaben im März 0,3 Prozent höher gewesen als im Vorjahresmonat. Für Restaurants etwa wird mehr ausgegeben als in den Vorjahren. Die Ausgaben für Güter des täglichen Bedarfs wiederum haben sich seit fast einem Jahr kaum verändert, Aufwendungen im Bereich Beauty und Wellness sind zuletzt gesunken. Beim Kleiderkauf seien die Menschen in der Schweiz zurückhaltender, die Gesundheitsausgaben hingegen seien weiter angestiegen. (ehs)
11:17 Uhr
Donnerstag, 18. April
ZVV setzt weiterhin auf Mehrfahrtenkarten
Im Februar berichtete der «K-Tipp», dass der öffentliche Verkehr in der Schweiz ab Ende 2025 die Mehrfahrtenkarten auf Papier abschaffe. Das sorgte für Kritik unter anderem von Pro Juventute und dem Konsumentenschutz . Für Personen, die nicht digital unterwegs seien, brauche es dringend alternative Lösungen.
Am Donnerstag hat nun mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) der erste regionale Anbieter bekannt gegeben, dass Mehrfahrtenkarten auf Papier auch nach 2025 Teile seines Sortiments bleiben. Dies, obwohl mittlerweile 7 von 10 Tickets digital gekauft würden.
Die Karten erfüllten weiterhin wichtige Bedürfnisse für Personen ohne digitale Kenntnisse und allein reisende Kinder, heisst es in einem Beitrag auf Instagram . ZVV-Direktor Dominik Brühwiler schreibt auf Linkedin von einem «Missverständnis»: Der nationale ÖV-Branchenverband Alliance Swisspass habe lediglich bekannt gegeben, dass ab 2025 die Transportunternehmen von ihrer Pflicht entbunden werden, die Kästen für die Entwertung von Mehrfahrtenkarten anzubieten. Dies sei oft fälschlicherweise als Ende der Mehrfahrtenkarte gedeutet worden, auch wenn schon damals festgehalten worden sei, dass regionale Lösungen auch nach 2025 weiterhin möglich seien.
Der ZVV denke weiterhin an jene Fahrgäste, die keine digitalen Kanäle nutzen könnten oder wollten, so Brühwiler. Bisher ist der Verbund der erste, der sich zur Zukunft der Mehrfahrtenkarten verlauten lassen hat. Der ZVV ist unter anderem für die Zürcher S-Bahn verantwortlich, die sich über acht Kantone erstreckt. (ehs)
10:47 Uhr
Donnerstag, 18. April
Mehr Diebstähle von E-Bikes
Im Jahr 2023 ist die Zahl der gestohlenen E-Bikes im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Vergleichsportals Hellosafe zurück. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 21'097 Straftaten in diesem Zusammenhang registriert.
Schweizweit wurden im Jahr 2023 2,4 Diebstähle von E-Bikes pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner gezählt. Wie gross die regionalen Unterschiede sind, zeigt die Auflistung der Diebstähle von konventionellen Velos. Im Kanton Basel-Stadt waren es mit 16,2 am meisten, danach folgen die Kantone Solothurn (4,6), Bern (4,5), Basel-Landschaft (3,9) und Aargau (3,5). Am anderen Ende der Rangliste stehen Appenzell Ausserrhoden, Schwyz und Nidwalden mit je 0,7 Diebstählen pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Portal bezieht sich dabei auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik.
Laut der Studie wird der Durchschnittspreis für ein neues E-Bike auf etwa 4'500 Franken geschätzt und jener für ein neues Velo auf 800 Franken. Diebstähle von Velos hätten bei den Versicherern im vergangenen Jahr Kosten in der Höhe von 83 Millionen Franken verursacht. In den vergangenen Jahren ist vor allem die Zahl der E-Bikes in der Schweiz stark gestiegen. Mittlerweile zählt laut der Studie mit 45 Prozent fast die Hälfte der Menschen in der Schweiz das Velofahren zu ihren wichtigsten körperlichen Aktivitäten. (ehs)
10:22 Uhr
Donnerstag, 18. April
ABB steigert Gewinn
Im ersten Quartal verzeichnete der Schweizer Industriekonzern ABB einen rückläufigen Auftragseingang. Gegenüber dem Vorjahresquartal ging er um 5 Prozent auf 9,0 Milliarden US-Dollar zurück. Der Umsatz blieb stabil bei 7,9 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Basis stieg er um 2 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebita) stieg um 11 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Die eigenen Erwartungen hat der Konzern damit übertroffen.
Der Auftragseingang sei trotz Rückgang höher als prognostiziert, wird Konzernchef Björn Rosengren zitiert. Neue Rekordmarken seien in den Geschäftsbereichen Elektrifizierung und Antriebstechnik gesetzt worden, während die Eingänge im Bereich Prozessautomation nachgegeben hätten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich tiefer lagen auch die Eingänge im Bereich Robotik und Fertigungsautomation.
Die rekordhohe operative Ebita-Marge sei eine «starke Leistung für ein erstes Quartal». Er sei nun «noch zuversichtlicher für 2024 als zu Beginn des Jahr». ABB habe noch Potenzial nach oben und könne mittelfristig Verbesserungen «im Rahmen des neuen ambitionierten Margen-Zielkorridors erreichen», so Rosengren. Im Gesamtjahr erwartet ABB ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und eine operative Ebita-Marge von etwa 18 Prozent. (ehs)
10:08 Uhr
Donnerstag, 18. April
SBB wollen grüner werden
Die SBB wollen bis ins Jahr 2030 ihre Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2018 halbieren und die Züge vollständig mit erneuerbaren Energien betreiben. Dazu will die Bahn über 200 Massnahmen zur Nachhaltigkeit umsetzen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Bereits heute würden 15 Prozent mehr Züge fahren als 2010, die aber 5 Prozent weniger Energie benötigten. Die betrieblichen CO2-Emissionen seien in nur fünf Jahren um 25 Prozent gesenkt worden.
Reduziert werden soll der Energieverbrauch mit Massnahmen wie der energieoptimierten Abstellung von Zügen. Zudem wollen die SBB mehr Photovoltaikanlagen auf ihren Anlagen und Freiflächen bauen. Bis ins Jahr 2040 sollen jährlich 160 GWh Strom produziert worden, was etwa dem Verbrauch der Einwohner der Stadt Luzern entspricht. Weiter wollen die SBB die Gebäudeheizungen auf erneuerbare Energien umrüsten und auf Baustellen vermehrt elektrisch betriebene Maschinen einsetzen.
Um das Engagement sichtbar zu machen, wird auf je einer Uhr in den Bahnhöfen Zürich HB, Lausanne und Bellinzona der Sekundenzeiger neu in grün gehalten, heisst es in der Mitteilung. (ehs)
11:48 Uhr
Mittwoch, 17. April
Digitec Galaxus: Datenschützer fordert Möglichkeit zu Gast-Bestellung
Einer der grössten Online-Shops der Schweiz muss beim Datenschutz nachbessern. Und das gleich mehrfach. Wie der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb) am Mittwoch mitteilt, muss Digitec Galaxus seinen Zwang zum Kundenkonto aufheben und künftig auch die Möglichkeit zur Bestellung als Gast anbieten. Das Unternehmen zeigt sich offen, dieser Forderung nachzukommen und will dem Datenschützer Vorschläge dazu präsentieren.
Nach Abschluss einer Untersuchung kommt der Edöb überdies zum Schluss, Digitec Galaxus verletze die Grundsätze der Transparenz und Verhältnismässigkeit auch in weiteren Punkten. Namentlich verlangt der Datenschützer, das Unternehmen müsse seine Datenschutzerklärung dahin gehend anpassen, «dass eindeutig über die Datenbearbeitungen informiert wird und klar ist, welche Daten für welche Zwecke bearbeitet und an welche Datenempfänger weitergegeben werden», wie es in einer Mitteilung heisst.
Allerdings hält der Edöb fest, einige der geforderten Anpassungen seien seit Beginn der Untersuchung aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes bereits erfolgt. Noch ausstehende Forderungen des Datenschützers sollen der «Datenbearbeitung ‹auf Vorrat›» entgegenwirken und die Transparenz für Kundinnen und Kunden weiter erhöhen. Diese Forderung lehnt Digitec Galaxus laut Datenschützer allerdings ab.
Bevor der Edöb darüber entscheidet, ob – und wenn ja, wie – er gegen Digitec Galaxus weiter vorgehen wird, will er nun abwarten, wie das Unternehmen auf seine Verbesserungsvorschläge eingeht. (sat)
10:02 Uhr
Mittwoch, 17. April
Neue Streaming-Tarife: Netflix wird bis zu 12 Prozent teurer – auch Sky passt Abos an
Am teuersten ist Netflix nicht teuer genug: Der hiesige Marktführer und bereits heute teuerste Streaming-Anbieter der Schweiz hebt seine Tarife dieser Tage nochmals weiter an. Und zwar um bis zu 12 Prozent, wie der Online-Vergleichdienst Moneyland.ch am Mittwoch mitteilt.
Zur Kasse gebeten werden dabei nicht nur Neu-Kunden. Sondern auch alle bisherigen Kundinnen sollen bei der anstehenden Erneuerung ihres Netflix-Abonnements den neuen Tarif berappen müssen.
Laut Moneyland ist dies insgesamt bereits die fünfte Preiserhöhung des US-Streamingdiensts in der Schweiz seit dem Markteintritt vor zehn Jahren. Die letzte Tarifrunde fand 2021 mitten in der Corona-Pandemie statt.
Konkret wird der Preis des Standard-Abos damit zum fünften Mal erhöht, jener des Premium-Abos zum vierten Mal. Beim Basic-Abo handelt es sich laut Moneyland.ch um die erste Preiserhöhung in der Schweiz.
Laut dem Online-Vergleichsdienst haben seit dem Netflix-Start 2014 zwei Abos besonders aufgeschlagen:
Der Preis des Standard-Abos kletterte um 8 Franken beziehungsweise 62 Prozent in die Höhe.
Das Premium-Abo stieg sogar um 10 Franken beziehungsweise 56 Prozent an.
Einzig beim Basic-Abo ist die Erhöhung in den vergangenen zehn Jahren laut Moneyland.ch «vergleichsweise moderat» ausgefallen mit plus 1 Franken beziehungsweise plus 8 Prozent.
Der Vergleich mit anderen Streamingdiensten hierzulande zeigt jedoch, dass Netflix mit der neuesten Tariferhöhung erst recht der teuerste Streamingdienst bleibt.
Das sind die Abo-Pläne von Konkurrent Sky
Allerdings wird es Ende Mai auch bei Konkurrent Sky zu Änderungen kommen. Einerseits schafft der Streaming-Anbieter die Jahresabos ab, wie aus Mails an bestehende Kunden hervorgeht.
Andererseits wird bei den Monatsabos ein Treueprogramm eingeführt. Nach sechs Monaten mit demselben Abo bezahlt man demnach künftig bei Sky automatisch einen reduzierten Tarif für die Nutzung.
Ab 27. Mai wird Sky hierzulande laut einer Medienmitteilung vom Montag folgende drei Monatsabos anbieten:
Sky Show light (mit Werbung) für 12,90 Fr./Monat (nach dem 6. Monat: 10,90 Fr./Monat)
Sky Show standard für 17,90 Fr./Monat (nach dem 6. Monat: 15,90 Fr.)
Sky Show premium für 24,90 Fr./Monat (nach dem 6. Monat: 20,90 Fr.)
«Mit Sky Show sind wir auf dem besten Weg, die beliebteste Adresse des Landes für Streaming von hochwertigen Serien und Filmen zu werden», wird Schweiz-CEO Eric Grignon in der Mitteilung zitiert. Die neue Preisgestaltung biete «ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, Flexibilität und macht unsere Inhalte noch mehr Menschen zugänglich».
Der Anbieter Sky ist – wie Konkurrent Netflix – eine Abo-Streaming-Plattform für Serien und Filme. Zusätzlich sind in den Sky-Abos auch rund zwei Dutzend kostenpflichtige Sky-Fernsehsender enthalten. Der hiesige Streamingdienst gehört zur deutschen Sky-Gruppe. (sat)
09:38 Uhr
Mittwoch, 17. April
Versicherungsmissbrauch: Suva «spart» 2023 über 32 Millionen Franken
Die Suva hat im vergangenen Jahr 2969 Meldungen mit Verdacht auf Missbrauch unter die Lupe genommen. Wie der Unfallversicherer am Mittwoch mitteilt, hat sich in 939 Fällen der Verdacht bestätigt. 2023 konnte die Suva demnach insgesamt 32,6 Millionen Franken «sparen», weil sie Missbrauchsfällen auf die Schliche kam.
Im Vergleich der letzten fünf Jahre fällt dieser Wert rund doppelt so hoch aus. Seit Einführung der Missbrauchsbekämpfung im Jahr 2007 konnte die Suva laut eigenen Angaben insgesamt sogar über 270 Millionen einsparen.
«Mit unserer Missbrauchsbekämpfung schützen wir die ehrlichen Prämienzahlenden», wird Roger Bolt in der Mitteilung zitiert. Darum herrscht laut dem Leiter Bekämpfung Versicherungsmissbrauch bei der Suva auch eine «Nulltoleranz» bei unrechtmässigem Bezug von Versicherungsleistungen.
Versicherungsmissbrauch liegt laut der Suva vor, wenn versicherte Betriebe, verunfallte Personen oder Leistungserbringende Prämien hinterziehen oder bewusst zu Unrecht Versicherungsgelder beziehen. Bei begründetem Verdacht kann der Unfallversicherer als letztes Mittel auch Versicherungsdetektivinnen und Versicherungsdetektive einsetzen. (sat)
15:30 Uhr
Dienstag, 16. April
Angebotsmieten erneut gestiegen
Die Angebotsmieten für Wohnungen in der Schweiz sind im März erneut gestiegen. Das zeigt laut einer Mitteilung der Homegate-Mietindex für Angebotsmieten. Im März ist der Index gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf nunmehr 126,8 Punkte gestiegen. Der Index wird vom Immobilienmarktplatz Homegate zusammen mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben.
Bis auf die beiden Appenzell, Thurgau und Basel Stadt haben sich die ausgeschriebenen Wohnungen in allen Kantonen verteuert. Die deutlichsten Erhöhungen im Vergleich zum Vormonat gab es in den Kantonen Schaffhausen (+3,5 Prozent), Nidwalden (+2,5 Prozent) und Zürich (+1,2 Prozent).
Gegenüber dem Vorjahr haben die Mieten insgesamt um 5,5 Prozent angezogen, wobei die Teuerungsraten in den Kantonen Schaffhausen, Zürich und Nidwalden im zweistelligen Prozentbereich lag.
14:10 Uhr
Dienstag, 16. April
Stadler baut zusätzliche Trams für Sarajevo
15 dreiteilige Trams des Typs Tango für 34,7 Millionen Euro – diesen Auftrag aus der bosnischen Hauptstadt Sarajevo hat der Schienenfahrzeughersteller Stadler im Herbst 2021 erhalten. Mittlerweile hat Sarajevo nachbestellt: Demnach liefert Stadler weitere 10 Tango-Trams im Wert von 29,7 Millionen Euro (28,8 Millionen Franken).
Die Beschaffung wird finanziert durch Kredite der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die ersten drei Fahrzeuge aus der ersten Tranche haben soeben in Sarajevo ihren Betrieb aufgenommen. Sie sind 70 km/h schnell und bieten Platz für je 180 Passagiere. (T.G.)
13:48 Uhr
DIENSTAG, 16. APRIL
Chinas Wirtschaft wächst kräftig
Chinas Wirtschaft ist nach offiziellen Angaben mit einem überraschend starken Wachstum ins Jahr gestartet. Wie das Statistikamt mitteilte, wuchs die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt hinter den USA im ersten Quartal um 5,3 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres. Experten hatten mit einem geringeren Wachstum gerechnet. Das Statistikamt sprach in der Mitteilung von einem «guten Start» ins Jahr.
Dagegen blieben andere wichtige Konjunkturdaten, die ebenfalls am Dienstag veröffentlicht wurden, hinter den Erwartungen zurück. So stieg die Industrieproduktion im März nach Angaben des Statistikamts im Jahresvergleich um 4,5 Prozent und damit langsamer als von manchen Analysten erhofft. Auch die Einzelhandelsumsätze lagen mit einem Plus von 3,1 Prozent unter den Prognosen.
Die chinesische Regierung strebt für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent an - ein ambitioniertes Ziel angesichts der Lage der Volksrepublik, die weiter unter dem Einfluss der Immobilienkrise und mangelender Konsumfreude steht.
Erst am Freitag hatten Aussenhandelszahlen gezeigt, dass die Erholung der exportgetriebenen Wirtschaft auf wackeligen Beinen steht. Vor allem die Exporte sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,5 Prozent in US-Dollar, wie die Zollbehörde am Freitag mitteilte. Die Importe gingen um 1,9 Prozent zurück. Experten hatten einen geringeren Rückgang bei den Exporten und sogar ein Plus bei den Importen erwartet. ( dpa )
11:23 Uhr
Dienstag, 16. April
Stabiler Lehrstellenmarkt
Der Lehrstellenmarkt präsentiere sich weitgehend stabil, schreibt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI in einer Medienmitteilung. Gesamtschweizerisch seien per Ende März 2024 knapp 40’000 Lehrverträge abgeschlossen gewesen, womit sich die Lehrstellenvergabe auf Vorjahresniveau bewege. Wie das Staatssekretariat weiter berichtet, seien auf dem offiziellen Lehrstellennachweis der Kantone rund 26’000 offene Lehrstellen für den Lehrbeginn 2024 ausgeschrieben gewesen. ( nav )
09:41 Uhr
Dienstag, 16. April
Rega investiert 200 Millionen in neue Heliflotte
Aktuell verfügt die Rega über 20 Helikopter unterschiedlicher Typen. Bis Ende des Jahres 2026 modernisiert sie ihre gesamte Helikopterflotte und nimmt 21 Rettungshelikopter der neuesten Generation in Betrieb. Dies geht aus dem am Dienstag publizierten Jahresbericht der gemeinnützigen Stiftung hervor. Künftig setzt die Rega auf das neueste Modell des Typs Airbus H145. Damit wird an allen Basen derselbe Helikoptertyp im Einsatz stehen. Die Investitionskosten belaufen sich auf mehr als 200 Millionen Franken.
Die Rega hat im letzten Jahr ein Betriebsergebnis von 28,2 Millionen Franken erzielt. Der Betriebsertrag belief sich auf 216,7 Millionen Franken. Davon stammten 134,5 Millionen von Gönnerinnen und Gönnern, Spenden und Nachlässen. Bei den restlichen Erträgen handelt es sich um Zahlungen für geleistete Einsätze, welche hauptsächlich Krankenkassen, Unfall- oder Reiseversicherer übernehmen. Die Rega beschäftigt 439 Mitarbeitende. Die Rega koordinierte im vergangenen Jahr 20647 Einsätze, bei drei Vierteln davon setzte sie auf Helikopter. (kä)
06:46 Uhr
Dienstag, 16. April
Swiss fliegt wieder nach Tel Aviv
Die Swiss fliegt wieder nach Tel Aviv. Der nächste Flug in die israelische Stadt findet heute Dienstag statt, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Die Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut hingegen bleiben bis und mit Donnerstag ausgesetzt. Auch meiden die Swiss-Flugzeuge den iranischen Luftraum. Iran hatte am Wochenende Israel mit rund 300 Drohnen angegriffen. (kä)
09:31 Uhr
Montag, 15. April
Samsung erobert den Smartphone-Thron zurück
Apple wurde 2023 mit seinem iPhone erstmals zur Nummer eins im Smartphone-Markt in einem gesamten Jahr. Doch zuletzt verkaufte der langjährige Spitzenreiter Samsung wieder deutlich mehr Geräte. Im vergangenen Quartal hat sich der südkoreanische Konzern den Spitzenplatz im Smartphone-Markt zurückerobert, wie Marktforscher berechnet haben. Knapp 21 Prozent der weltweit verkauften Geräte kamen demnach von Samsung, wie die Analysefirma IDC in der Nacht zum Montag berichtete.
Apples iPhone kam gemäss den Angaben auf einen Marktanteil von 17,3 Prozent. Auf Platz drei sieht IDC den chinesischen Anbieter Xiaomi, der mit einem Absatzplus von gut einem Drittel auf rund 14 Prozent Marktanteil kam.
Den stärksten Schub verzeichnete der vor allem in Afrika aktive chinesische Anbieter Transsion, der mit einem Absatzplus von rund 85 Prozent etwa jedes zehnte Smartphone weltweit verkaufte und auf Rang vier sprang.
Insgesamt wuchs der Smartphone-Markt nach einer längeren Schwächephase wieder um 7,8 Prozent auf 289,4 Millionen Geräte, wie IDC errechnete. Die Analysefirma ist eines der Marktforschungsunternehmen, die regelmässig den Absatz von Elektronik schätzen. Von den Herstellern selbst gibt es keine Angaben mehr dazu. (dpa)
15:44 Uhr
Donnerstag, 11. April
René Benkos Signa Holding meldet Konkurs an
Die insolvente Signa-Holding des gefallenen Immobilienmilliardärs René Benko hat ein Konkursverfahren beim Handelsgericht Wien beantragt. Dies, nachdem sie zuvor ihren Sanierungsplan-Antrag zurückgezogen hatte. Dies teilte der Insolvenzverwalter Christof Stapf am Donnerstag mit, wie mehrere Medien berichten. Eine Mindestquote zur Bedienung der Forderungen der Gläubiger fällt damit laut Stapf weg. Zur Signa-Holding gehörte in Deutschland die Warenhauskette Galeria, in der Schweiz Globus.
Ende November hatte die Signa Holding Insolvenz angemeldet. Zur Krise beim Handels- und Immobilienkonzern kam es aufgrund von hohen Baukosten, steigende Kreditzinsen und internen Problemen. (red)
08:00 Uhr
Donnerstag, 11. April
Roche-Test schürt Hoffnung für Alzheimer-Kranke
Der Basler Pharmakonzern kann im Bereich Alzheimer einen Erfolg verbuchen. Und zwar hat die amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) einen Roche-Bluttest als «Breakthrough Device» ausgezeichnet. Das sind neuartige Medikamente oder Therapien für schwerkranke Patienten, die dank eines Sonderzulassungsverfahren möglichst rasch zugänglich sein sollen.
Den Test hat Roche zusammen mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly entwickelt. Er soll krankhafte Veränderungen bei den Amyloid-Proteinen anzeigen. Bei Alzheimer-Kranken verklumpen diese und lagern sich ab. Wie Roche am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, könnte der Test im Falle einer Zulassung eine frühere und genaueren Diagnose ermöglichen. So könnte er dazu beitragen, die Auswirkungen der Alzheimer-Krankheit auf Menschen und Gesellschaft abzumildern.
Alzheimer nehme weltweit zu, doch drei Viertel der Fälle blieben unentdeckt, wie sich Matt Sause, Chef von Roche Diagnostics, zitieren lässt. Der Diagnostik komme deshalb eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Alzheimer zu.
Roche kann den Zwischenerfolg dringend brauchen. Der Pharmakonzern machte zuletzt eher mit einem schwächelnden Aktienkurs und diversen Forschungsflops Schlagzeilen. Auch im Alzheimer-Bereich: Ein Medikament, das den geistigen Verfall aufhalten sollte, verfehlte Ende 2022 die Wirkungsziele in einer Studie so deutlich, dass das teure Forschungsprojekt eingestellt wurde. (aka)
07:23 Uhr
Donnerstag, 11. April
Testbericht: Swisscom bietet das beste Netz in der Schweiz
Das Fachmagazin Chip hat in einem Test die Schweizer Mobilfunkanbieter verglichen. Das Resultat dürfte den Branchenprimus freuen: Demnach bietet die Swisscom in allen Kategorien das beste Netz, wie Chip am Donnerstag mitteilt. Sie gewinne nicht nur den Netztest, sondern auch jenen für das beste 5G-Netz und das beste Netz in den Zügen. Beim mobilen Internet und Telefonie habe die Swisscom ebenfalls die Nase vorne.
Doch das schlägt sich auch in den Preisen nieder: Laut Chip führt die Swisscom zwar «in allen Belangen, aber leider gilt das auch für die Preise». Wer einen günstigen Tarif in einem anderen Netz buche, treffe damit auch keine schlechte Wahl.
Hinter der Swisscom gebe es einen engen Zweikampf zwischen Sunrise und Salt. «Während Sunrise im letzten Test noch mit der Swisscom um den Sieg in der Schweiz kämpfte, muss der Netzbetreiber eher aufpassen, nicht von Salt überholt zu werden», schreibt das Fachmagazin.
Salt habe bei der 5G-Verfügbarkeit und in der Folge auch beim mobilen Internet stark aufgeholt. Zwar liege Sunrise noch in beiden Kategorien vorne, aber beim Telefonieren ziehe Salt vorbei. Chip nennt die Nummer drei im Schweizer Markt deshalb den «Aufsteiger des Jahres».
Insgesamt hat die Schweiz laut Chip die besten Netze im deutschsprachigen Raum – auch dank des raschen 5G-Ausbaus. So bekommen alle drei grossen Anbieter vom Fachmagazin sehr gute Noten. (aka)
06:42 Uhr
Donnerstag, 11. April
Über eine Million Menschen reisen auf das Jungfraujoch
Es sei «das beste Unternehmensergebnis in der Geschichte»: Die Jungfraubahngruppe konnte ihren Gewinn 2023 auf 79,6 Millionen Franken steigern. Das ist fast 80 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bergbahnunternehmen am Donnerstagmorgen mitteilt. Der Verkehrsertrag, die wichtigste Stütze der Einnahmen, ist ebenfalls deutlich gestiegen: um 40 Prozent auf 195,9 Millionen Franken. Fast verdoppeln will der Verwaltungsrat die Dividenden: Pro Aktie sollen die Aktionäre 6.50 Franken erhalten – im Vorjahr waren es noch 3.60 Franken.
Über eine Millionen Menschen reisten im vergangenen Jahr auf das Jungfraujoch. Die Marke sei «erstmals seit 2019 und erst zum fünften Mal überhaupt» übertroffen worden. Die Besucherzahl lag 61,1 Prozent höher als 2022 und nur noch 4,6 Prozent unter dem Wert des letzten Vorkrisenjahrs 2019. Für die Zunahme verantwortlich waren vor allem Gäste aus Südostasien, Indien und den USA. «Nebst den zahlreichen Einzelreisenden besuchten vermehrt auch wieder Gruppen das Jungfraujoch», schreibt das Bahnunternehmen.
Auch die Skisaison verlief erfreulich für die Jungfraubahnen. In der laufenden Wintersaison 2023/2024 habe eine gute Schneedecke einen durchgehenden Wintersportbetrieb ab Anfang Dezember ermöglicht. Bis Ende März 2024 registrierten die Bahnen rund 1,08 Millionen Skier Visits – 6 Prozent mehr als in der gleichen Zeitspanne in der Vorsaison. (aka)
09:06 Uhr
Mittwoch, 10. April
Kantonsranking: In Zug und Schwyz fahren die teuersten Autos
Auf den Strassen des Kantons Zug sind schweizweit die teuersten Autos unterwegs. Das zeigt eine Statistik, welche der Versicherer Axa am Mittwoch veröffentlicht hat. Der durchschnittliche Fahrzeugwert beträgt dort rund 65'000 Franken. Das ist 30 Prozent mehr als im Schweizer Schnitt. An zweiter Stelle steht der Kanton Schwyz mit etwas mehr als 58’000 Franken, gefolgt von Appenzell Innerrhoden mit knapp 55’000 Franken.
Über dem Durchschnitt liegen auch die Kantone Graubünden, Basel-Stadt, Zürich, Nidwalden, Basel-Land, Obwalden, Aargau, Wallis und Genf. Die günstigsten Autos sind in den Kantonen Jura, Neuenburg und Freiburg unterwegs. Dort beträgt der durchschnittliche Fahrzeugwert zwischen 43‘000 und etwas mehr als 44’000 Franken, also über 20‘000 Franken weniger als im Kanton Zug. (rwa)
08:57 Uhr
Mittwoch, 10. April
Barry Callebaut bolzt Umsatz dank rekordhoher Kakaopreise
Der weltweit tätige Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat im letzten halben Jahr 0,7 Prozent mehr Ware verkauft. Das entspricht insgesamt 1,138 Millionen Tonnen. Der Umsatz stieg derweil um 11,1 Prozent auf 4,6 Milliarden Franken. Hier konnte das Unternehmen mit Sitz in Zürich vom rekordhohen Kakaopreis profitieren. Dieser ist innerhalb eines Jahres um mehr als 270 Prozent angestiegen. Unter dem Strich blieb Barry Callebaut ein Reingewinn von 215,8 Millionen Franken. Das ist deutlich weniger als in der Vorjahresperiode (-7,9 Prozent).
Um die Kosten langfristig zu reduzieren, hat Barry Callebaut bereits im Herbst ein Sparprogramm angekündigt. Die Umsetzung gehe wie geplant voran, heisst es in der Mitteilung. Barry Callebaut will 2500 Stellen streichen und zwei Fabriken schliessen. Damit möchte das Unternehmen 250 Millionen Franken sparen. (mpa)
06:03 Uhr
Mittwoch, 10. April
Grosse Preisunterschiede bei Internet-Abos
Für viele Konsumentinnen und Konsumenten ist ein guter Internetzugang zu Hause mittlerweile wichtig. Vor allem Berufstätige, die im Homeoffice arbeiten, legen Wert auf ein gutes Internet-Abo. Allerdings lohnt es sich, die Preise der Anbieter zu vergleichen. Denn es gibt grosse Unterschiede, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Auswertung des Online-Vergleichsdienstes moneyland.ch zeigt.
Bei Internet-Abos mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s lassen sich demnach jährlich fast 200 Franken sparen. So kostet das Abo bei Sunrise und Salt im ersten Jahr fast 700 Franken, während es bei den günstigsten Anbietern Teleboy und iWay mit 500 Franken zu Buche schlägt. Swisscom ist gar 55 Prozent teurer als der günstigste Anbieter, Yallo sogar 63 Prozent.
Egal um welches Internet-Abo es sich handelt: Gemäss moneyland.ch sind Teleboy und iWay in jedem Fall am günstigsten. Von den grossen drei Anbietern macht Sunrise das Rennen, sehr knapp gefolgt von Salt. Swisscom ist von den drei grossen Anbietern der teuerste Anbieter. (rwa)
11:41 Uhr
Dienstag, 9. April
Rekordjahr für Lauterkeitskommission
124 Beschwerdeverfahren hat die Schweizerische Lauterkeitskommission im vergangenen Jahr durchgeführt - das bedeutet einen neuen Rekordwert. Gegenüber 2022 stieg die Anzahl Beschwerdeverfahren um rund 40 Prozent; der langjährige Jahresdurschnitt liegt bei rund 90 Verfahren.
Die Lauterkeitskommission ist die neutrale, unabhängige Institution der Kommunikationsbranche zum Zweck der werblichen Selbstkontrolle. Aus dem am Dienstag publizierten Jahresbericht geht hervor, dass sich die meisten Beschwerden um klassische Konsumententhemen drehen. Am meisten betrafen die Branche Lebensmittel/Getränke (14 Prozent), gefolgt von den Branchen Haus/Garten (10.5 Prozent) und Freizeit/Touristik (9.9. Prozent). Mehr Beschwerden als im Vorjahr gab es in den Bereichen Pharma/Gesundheit sowie Alkohol/Tabak, weniger beim Versandhandel, der Unterhaltungselektronik und bei Haushaltartikeln.
Der in Beschwerden am häufigsten erhobene Vorwurf ist Unrichtigkeit bzw. Irreführung durch Werbung (30.5 Prozent). Dahinter folgen aggressive Verkaufsmethoden (28.5 Prozent) und Geschlechterdiskriminierung (13.9 Prozent). 2023 wurden 54.4 Prozent der Beschwerden gutgeheissen. Für weltweite Schlagzeilen sorgte der Entscheid der Lauterkeitskommission, die Beschwerde gegen die Kommunikation der FIFA, wonach die WM 2022 in Katar klimaneutral sei, gutzuheissen. Der Entscheid aus dem Jahr 2023 ist unterdessen rechtskräftig. (cbe)
10:30 Uhr
Dienstag, 9. April
Schweizer Firmen verloren Millionen an Identitätsdiebe
Die Täter operierten wohl von Israel aus. Per Telefon kontaktierten sie mehrere in der Schweiz ansässige Firmen und gaben sich als Mitarbeitende ihrer Bank aus. Unter dem Vorwand, das E-Banking-System anzupassen, verschafften sie sich Zugang zum Computer der Opfer – und zweigten mehrfach hohe Summen ab. So betrogen sie sieben Schweizer Firmen um mehr als 5 Millionen Franken.
So beschreibt den Fall die Bundesanwaltschaft. Wie die Behörde am Dienstag mitteilt, hat sie Anklage erhoben gegen einen französisch-israelischen Doppelbürger. Er soll Teil der Gruppe gewesen sein, die von Dezember 2016 bis August 2018 aktiv war.
Identifiziert wurde der Mann laut der Bundesanwaltschaft dank einer engen Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol), die Banken der geschädigten Unternehmen, die Kantone und andere Länder als die Schweiz waren involviert. 2021 stellte die Bundesanwaltschaft einen internationalen Haftbefehl gegen den Beschuldigten aus. Kurz darauf wurde dieser an einem Flughafen in den USA gefasst und an die Schweiz ausgeliefert.
Trotz der Ermittlungen und Rechtshilfegesuche hätten die anderen Mitglieder der Gruppe nicht identifiziert werden können, heisst es weiter. Doch dank Telefonüberwachung habe man weitere missbräuchliche Überweisungen in Höhe von rund 3 Millionen Franken verhindert. (aka)
09:35 Uhr
Dienstag, 9. April
Anzahl Konkursverfahren erreicht neuen Rekordwert
Im Jahr 2023 wurden 15’447 Firmen- und Privatkonkursverfahren neu eröffnet, 2,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Damit wurde erstmals seit Beginn der Zeitreihe (2008) in drei aufeinanderfolgenden Jahren ein Anstieg registriert. Dies geht aus der Betreibungs- und Konkursstatistik hervor, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag publiziert. Damit wurde 2023 einmal mehr ein neuer Rekordwert verzeichnet. Immerhin: Gegenüber den letzten beiden Jahren hat sich das Wachstum mit 2.9 Prozent deutlich verlangsamt (2021: +9,1 Prozent; 2022: +6,6 Prozent).
Die finanziellen Verluste aus ordentlichen und summarischen Konkursverfahren haben sich gegenüber 2022 verringert. Sie sanken um 11,7 Prozent auf 2 Milliarden Franken.
Wie das BFS schreibt, ist die Zahl der laufenden Betreibungsverfahren nicht verfügbar. In der Statistik werden die Anzahl Zahlungsbefehle, Pfändungsvollzüge und Verwertungen erhoben, also die Anzahl Erlasse der Betreibungsämter. Allerdings können im Rahmen eines einzelnen Betreibungsverfahrens mehrere Erlasse wie Zahlungsbefehle ausgestellt werden, etwa dann, wenn mehrere Mitschuldner involviert sind.
Dennoch vermittle die Erhebung dieser Erlasse ein allgemeines Bild der Entwicklung im Betreibungswesen, hält das BFS fest. Die Anzahl der Zahlungsbefehle, die sich während der Pandemiejahre (2020-2022) bei rund 2,7 Millionen eingependelt hatte, stieg im Jahr 2023 sprunghaft um 10,7 Prozent auf über 3 Millionen an. Damit näherte sie sich dem Rekordwert aus dem Jahr 2019 an. Die Anzahl der Pfändungsvollzüge und Verwertungen hingegen lag 2023 im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. (cbe)
06:44 Uhr
Dienstag, 9. April
Sensirion gibt Standort Berlin auf
Der Mikrosensorenhersteller Sensirion AG aus Stäfa ZH steigt aus dem Bereich der Zustandsüberwachung aus. In diesem Zusammenhang schliesst das Unternehmen seinen Standort in Berlin. Erst im September 2021 hatte Sensirion das Berliner Start-Up AiSight übernommen mit dem Ziel, ein führender Anbieter von Gesamtlösungen im Bereich der Zustandsüberwachung zu werden. Doch jetzt zieht Sensirion die Reissleine: «In der Zwischenzeit hat sich jedoch gezeigt, dass sich der Markt für Zustandsüberwachung deutlich langsamer und fragmentierter entwickelt als ursprünglich angenommen», schreibt das Unternehmen am Dienstag in einer Medienmitteilung. Es gebe eine Vielzahl von Wettbewerbern, gegenüber denen eine technische Differenzierung nur schwer möglich sein werde.
Diese Marktstruktur passe strategisch nicht zum Anspruch von Sensirion, durch Innovationen zum führenden Anbieter im jeweiligen Bereich zu werden. Mit dem Ausstieg aus dem Bereich der Zustandsüberwachung geht die Schliessung des Standorts in Berlin einher. Man bedauere den Wegfall der dortigen Arbeitsplätze sehr, und werde die betroffenen Mitarbeitenden bei der Suche nach einer Tätigkeit bestmöglich unterstützen.
Finanziell führe der Entscheid zu einer ausserordentlichen, nicht liquiditätswirksamen Wertberichtigung von rund 25 Millionen Franken. Für das laufende Jahr rechnet Sensirion im Zusammenhang mit dem Entscheid mit Restrukturierungskosten und Rückstellungen im in Höhe von rund 3 bis 5 Millionen Franken. Der Entscheid werde «keine wesentlichen Auswirkungen auf Sensirions mittel- und langfristiges Wachstumspotential haben», ist man überzeugt. (cbe)
17:25 Uhr
Montag, 8. April
Stadler liefert Züge nach Bulgarien
Bulgarien hat dem Schienenfahrzeughersteller Stadler einen Auftrag im Wert von gut 300 Millionen Lew oder umgerechnet 153,6 Millionen Euro erteilt. Stadlers polnische Tochtergesellschaft Stadler Polska wird dafür sieben doppelstöckige elektrische Triebzüge des Typs Kiss mit jeweils mindestens 300 Sitzplätzen liefern.
Die Beschaffung umfasst auch einen Vertrag zur Wartung der Züge während 15 Jahren. Das neue Rollmaterial soll laut einer Mitteilung auf der Website des bulgarischen Verkehrsministeriums innert 26 Monaten geliefert werden. Bulgarien ist für Stadler ein neuer Markt. (T.G.)
16:42 Uhr
Montag, 8. April
Swiss: Weniger als 5 Prozent kompensieren Emissionen
Swiss-Chef Dieter Vranckx kündigt in einem Interview mit dem «AeroTelegraph» an , dass es auf ausgewählten Verbindungen der Fluggesellschaft innerhalb von Europa nur noch sogenannte grüne Tarife geben könnte. Bei diesen «Green Fares» wird ein zusätzlicher Betrag fällig, den die Airline zur Kompensation von CO 2 -Emissionen nutzt – standardmässig zu 20 Prozent durch Einsatz von nachhaltigem Treibstoff (SAF) und zu 80 Prozent durch Investitionen in Klimaschutzprojekte.
Auf der Strecke Zürich-Genf gibt es nur noch solche Tarife zu kaufen. Die Nachfrage habe sich dadurch nicht verändert, sagt Vranckx. «Wir schauen uns Strecken in Europa an, wo wir auch ausschliesslich grüne Tarife einführen könnten – analog zu Genf-Zürich.» Allerdings sei das Vorhaben «nicht so einfach» umzusetzen.
Kundinnen und Kunden der Swiss können auf vielen Strecken bereits heute freiwillig grüne Tarife buchen. Laut Vranckx kaufen allerdings weniger als 5 Prozent der Reisenden als Kompensation SAF dazu. Es brauche «viel mehr». Der Anteil nehme zu, aber in kleinen Schritten. Der Airline-Chef, der im Juli in den Vorstand der Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa wechselt, plädiert für staatliche Hilfe beim Aufbau der SAF-Produktion. «Es wäre wichtig, dass sich der Staat Gedanken macht, ob man das mit Startkapital unterstützen kann», sagt er. (ehs)
11:35 Uhr
Montag, 8. April
Mehr Fahrten mit Lime in der Schweiz
Lime, ein US-amerikanischer Anbieter von E-Trottinetts und Elektrovelos zum Ausleihen, hat im Jahr 2023 weltweit über 150 Millionen Fahrten gezählt und dabei einen Gesamtumsatz von 616 Millionen US-Dollar erzielt. Laut einer Mitteilung vom Montag war Lime zum zweiten Mal in Folge profitabel. Das bereinigte Ebitda stieg auf über 90 Millionen US-Dollar.
Auch in der Schweiz war Lime demnach profitabel. Die Zahl der Fahrten stieg hier im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent, die Zahl der Benutzerinnen und Benutzer um 19 Prozent und der Gesamtumsatz um 42 Prozent.
Lime bietet seine Fahrzeuge weltweit in 280 Städten in fast 30 Ländern an. Das vergangene Jahr habe einen Wendepunkt markiert, wird Unternehmenschef Wayne Ting zitiert. Das deutliche Wachstum beim Umsatz und Gewinn bestätige, dass ein widerstandsfähiges Unternehmen aufgebaut werde, das in der Lage sei, langfristig einen Beitrag zu klimafreundlichem Verkehr zu leisten.
In der Schweiz stehen Fahrzeuge von Lime gemäss Angaben auf der Internetseite der Firma in Basel, Zug, Winterthur und Zürich sowie in den Zürcher Gemeinden Opfikon, Uster und Wetzikon zur Verfügung. (ehs)
08:54 Uhr
Montag, 8. April
Arbeitslosenquote verharrt bei 2,4 Prozent
Ende März waren 108'953 Menschen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos eingeschrieben. Das sind 3286 weniger als im Vormonat, aber 15'838 Personen oder 17,1 Prozent mehr als im März vor einem Jahr. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mit. Die Arbeitslosenquote verharrte damit bei 2,4 Prozent.
Die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen verringerte sich im März um 943 auf 42'413. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Zahl der Arbeitslosen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren um 11,0 Prozent auf 30'594 zu. Eine Zunahme wurde auch bei der Jugendarbeitslosigkeit verzeichnet: Im Vergleich zum März 2023 nahm diese um 1'275 Personen oder 15,5 Prozent auf 9'505 zu.
Einen starken Rückgang verzeichnete das Seco zuletzt hingegen bei der Kurzarbeit. Im Januar waren 2'719 Personen von Kurzarbeit betroffen, die ausgefallenen Arbeitsstunden summierten sich auf 132'895 Stunden. Im Januar 2023 waren noch 3'388 Personen und die Zahl der ausgefallenen Arbeitsstunden hatte 186'731 betragen. (ehs)
14:47 Uhr
Freitag, 5. April
Chefwechsel bei Fenaco
Am 1. März hatte Martin Keller bekannt gegeben, dass er nach 13 Jahren an der Spitze von Fenaco den Chefposten abgebe. Nun ist klar, wer ihn beerben wird: Ab Juli wird Michael Feitknecht die Agrargenossenschaft lenken, zu der etwa die Landi-Läden, die Agrola-Tankstellen, das Ufa-Saatgut oder die Landor-Dünger gehören. Derzeit leitet der 41-Jährige als Fenaco-Geschäftsleitungsmitglied das Departement Pflanzenbau. Diese Funktion geht nun an den Landor-Chef Jürg Friedli. Bevor Feitknecht 2018 zu Fenaco stiess, war er zehn Jahren bei Syngenta. (fv)
12:59 Uhr
Freitag, 5. April
Mehr Bahn-Passagiere zwischen Zürich und München
Die Bahn-Verbindung zwischen München und Zürich gehört zu den fünf wachstumsstärksten internationalen Strecken der Deutschen Bahn (DB). Das teilte sie am Donnerstag mit. Im Jahr 2023 nutzten 17'000 mehr Fahrgäste als im Vorjahr die Züge auf dieser Strecke. Das entspricht einem Plus von 16 Prozent. Insgesamt waren demnach fast 110'000 Menschen mit dem Zug zwischen den beiden Städten unterwegs. Im Dezember wurde das Angebot mit einem siebten täglichen Zugpaar ausgebaut. Noch stärker zugenommen hat der Verkehr laut DB zwischen Berlin und Amsterdam (+23%), Berlin und Warschau (+22%), München und Verona (+20%) und München und Wien (+17%).
Auch im Vergleich zum Jahr 2019 und damit vor der Coronakrise nutzten vergangenes Jahr mit einem Zuwachs von 21 Prozent auf 24 Millionen deutlich mehr Passagiere die grenzüberschreitenden Züge der DB. Das liege an kurzen Reisezeiten von Innenstadt zu Innendstadt, den attraktiven Preisen und der klimafreundlichen Art des Reisens, schreibt die Bahn.
Wie die DB weiter mitteilt, werden ab Sommer erstmals die Giruno-Züge der SBB, die von Hersteller Stadler gebaut wurden, auf der Verbindung Frankfurt-Zürich-Mailand zum Einsatz kommen. Von einem Boom von internationalen Zugreisen berichteten zuletzt auch die SBB: Anlässlich der Präsentation ihrer Jahreszahlen gaben sie im März bekannt, dass sich die Verkehrsleistung im internationalen Fernverkehr im Jahr 2023 gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2022 um noch einmal 15,2 Prozent gesteigert habe. Insgesamt zählten die SBB letztes Jahr 12,3 Millionen internationale Reisende, davon 600'000 in Nachtzügen. (ehs)
08:10 Uhr
Freitag, 5. April
Skigebiete: März «viel zu warm»
Im März sind etwa gleich viele Ersteintritte in Schweizer Skigebiete verzeichnet worden wie im Februar. Das teilt der Verband Seilbahnen Schweiz am Freitag mit. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche das einem Plus von 5 Prozent. Der Verband spricht von einem «positiven Signal», wenn man die «speziellen und teils problematischen Wetterbedingungen» berücksichtigt.
Denn die Zunahme täuscht: In diesem Jahr fielen die aufkommensstarken Oster-Feiertage bereits auf Ende März. Davon hätten die Skigebiete nur bedingt profitieren können, heisst es in der Mitteilung. Viele Skigebiete hätten ihren Betrieb während mehrere Tage wegen starkem Wind einstellen müssen. Wie bereits der Februar sei auch der März «viel zu warm» gewesen.
Die regionalen Unterschiede sind beträchtlich. In der Ostschweiz wurden seit Beginn der aktuellen Saison bis und mit Ende März 11 Prozent mehr Eintritte gezählt als im Vorjahr, in Graubünden 9 Prozent mehr und in den Waadtländer Alpen 8 Prozent mehr. Ebenfalls im Plus liegen die Gebiete in der Zentralschweiz (+6%) und im Wallis (+4%). Gar 43 Prozent mehr Ersteintritte verzeichnete das Tessin – auch wenn das Wetter dort an Ostern «sehr feucht und nass» gewesen sei. Einen Rückgang verzeichnen mussten diese Saison hingegen das Berner Oberland (-4%), die Jura-Region (-21%) und die Freiburger Alpen (-31%).
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre waren in der aktuellen Wintersaison bis Ende März 4 Prozent mehr Gäste unterwegs. Auch in dieser Betrachtung gewannen einige Regionen - etwa das Wallis mit einer Zunahme von 11 Prozent, Graubünden und die Waadtländer Alpen mit einer Zunahme von je 10 Prozent oder die Ostschweiz mit 6 Prozent mehr Eintritten, während das Berner Oberland 17 Prozent weniger Eintritte zählte als im Fünf-Jahres-Schnitt. Noch grösser waren die Rückgänge in den Freiburger Alpen (-39%) und im Jurabogen (-79%). Leicht unter dem langjährigen Durchschnitt lagen die Eintritte auch in der Zentralschweiz (-1%) und im Tessin (-2%), wie der Verband mitteilt. (ehs)
07:49 Uhr
Freitag, 5. April
Holcim übernimmt Tensolite
Der Schweizer Baustoffproduzent Holcim will Tensolite übernehmen, einen argentinischen Hersteller von Fertigteil- und Spannbetonbausystemen. Das teilt er am Freitag mit. Tensolite mit einem Nettoumsatz von 22 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 verfüge über eine starke Präsenz in den schnell wachsenden Märkten Lateinamerikas und über Werke und ein Vertriebsnetz in Argentinien, Paraguay und Uruguay.
Tensolite beschäftigt 155 Mitarbeitende und wurde 1979 gegründet. Das Unternehmen stellt unter anderem Balken, Dachsteine und Fertigteilwände her. Laut der Mitteilung sind rund 80 Prozent der Einfamilienhäuser in Argentinien mit Betonbalken gebaut worden, weshalb es sich um einen Markt mit grossem Potenzial handle.
Mit der Übernahme will Holcim einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Strategie gehen, die vorsieht, dass der Geschäftsbereich Solutions & Products bis im Jahr 2025 seinen Anteil am Konzernumsatz auf 30 Prozent erhöht. Holcim wolle «in die attraktivsten Segmente der Bauindustrie eintreten, von der Bedachung und Isolierung bis hin zu Reparatur und Sanierung», heisst es weiter. Der Abschluss der Übernahme wird vorbehalten der behördlichen Genehmigung im 2. Quartal erwartet. (ehs)
07:06 Uhr
Freitag, 5. April
Industriellenfamilie steigt bei Implenia ein
Der Investor Max Rössler hat seine Nachfolge als Ankeraktionär des Schweizer Baukonzerns Implenia geregelt. Wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst, übernimmt die in Cham ZG beheimatete Buru-Holding, die im Besitz der Zuger Industriellenfirma Buhofer ist, von ihm eine signifikante Beteiligung von 13,7 Prozent an Implenia.
Der Präsident des Verwaltungsrats von Implenia, Hans Ulrich Meister, wird damit zitiert, er freue sich, dass mit dieser Lösung die Stabilität im Aktionariat gewährleistet bleibe. Er danke Rössler für seine «jahrzehntelange Treue», die ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Unternehmens gewesen sei.
Der 84-jährige Rössler ist an mehreren Schweizer Unternehmen beteiligt, neben Implenia etwa auch am Werkzeughersteller Starrag Group. Die Familie Buhofer wiederum verdankt ihr Vermögen zu einem grossen Teil einer Beteiligung am Industrieunternehmen Metall Zug.
Der Baukonzern Implenia mit Sitz im zürcherischen Opfikon beschäftigt europaweit über 9000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 3,6 Milliarden Franken. Er ist im Hoch- und Tiefbau tätig sowie im Tunnelbau. Implenia ist an der Schweizer Börse kotiert und entstand im Jahr 2006 aus der Fusion der Batigroup Holding und der Zschokke Holding. (ehs)
18:30 Uhr
Donnerstag, 4. April
Swiss-Steel-Aktionariat ebnet Weg für Sanierung
Lichtblick für den in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Stahlkocher Swiss Steel: Das Aktionariat des Luzerner Industriekonzerns hat an der gestrigen ausserordentlichen Generalversammlung mit grosser Mehrheit für die geplante Kapitalerhöhung gestimmt. Damit will Swiss Steel mindestens 300 Millionen Euro, rund 295 Millionen Franken, einnehmen.
Grossaktionär Martin Haefner, der über seine Gesellschaft Bigpoint fast ein Drittel der Anteile am Unternehmen hält, hatte bei der Veranstaltung in Emmenbrücke mit Erfolg für die Finanzspritze geweibelt. Am Ende votierten 99,79 Prozent mit «Ja». An der GV waren insgesamt 132 Aktionäre anwesend, die rund 90 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapital vertraten.
Mit dem frischen Geld soll die Sanierung des angeschlagenen Konzerns vorangetrieben werden. Diese ist dringend notwendig. Im letzen Geschäftsjahr hatte Swiss Steel einen Verlust von fast 300 Millionen Franken eingefahren, unter anderem infolge der globalen Schwäche in der Stahlbranche. Die Eigenkapitalquote schrumpfte von 22 auf 12 Prozent zusammen, was den Konzern in akute Liquiditätsschwierigkeiten brachte.
Mit dem Aktionärsbeschluss von gestern kann Swiss Steel nun wie geplant 3,1 Milliarden neue Aktien zu einem Nennwert von 0.08 Franken ausgeben. (gr)
15:45 Uhr
Donnerstag, 4. April
Alstom gewinnt Auftrag der SBB
Der französische Bahnbauer Alstom hat einen Vertrag der SBB für die Korrosionssanierung von 250 Wagen der Doppelstock-Fernverkehrszüge des Typs IC 2000 erhalten. Dieser hat einen Wert von 62,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Alstom-Standort in Villeneuve VD werde den Auftrag ab Herbst und bis im Jahr 2030 durchführen. Daniel Novak, der Leiter Grossprojekte Flotte der SBB wird damit zitiert, dass die IC-2000-Flotte zentral sei für den Fernverkehr.
Die IC 2000 wurden ab dem Jahr 1997 von einem Konsortium gefertigt, dem unter anderem Alstom und der damalige Schweizer Wagenbauer Schindler angehörten. Schindler ging danach in Adtranz und später in Bombardier auf. Die Bahnsparte von Bombardier wiederum gehört seit drei Jahren zu Alstom. Der Auftrag geht also an jene Firma, welche die Züge zu einem grossen Teil bereits produziert hat. Im Jahr 2010 hatte Bombardier auch den Auftrag für die Produktion der Nachfolgezüge gewonnen, die sogenannten FV-Dosto. Von diesen wurden mittlerweile alle 62 Züge an die SBB abgeliefert. Der Auftrag für die FV-Dosto war mit einem Volumen von 1,9 Milliarden Franken der damals grösste in der Geschichte der SBB. Die Endmontage der FV-Dosto erfolgte im Werk in Villeneuve. Auch weil die Produktion mittlerweile abgeschlossen ist und die Franzosen seither keine grösseren Aufträge für neue Züge in der Schweiz mehr gewonnen haben, hat Alstom das dortige Werk zu einem Service-Standort umfunktioniert.
Ob Alstom dereinst wieder neue Züge für die SBB bauen kann, ist offen. Der letzte grosse Auftrag zur Beschaffung von einstöckigen Triebzügen für den Regionalverkehr für rund 2 Milliarden Franken ging 2021 an den Schweizer Bahnbauer Stadler. Alstom hatte sich – wie der deutsche Bahnbauer Siemens – ebenfalls beworben, war aber unterlegen. Eine Klage dagegen vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde von diesem abgewiesen.
Die nächste grosse Beschaffung der SBB wurde im Jahr 2023 mit einer Informationsbeschaffung bei potenziellen Herstellern eingeleitet . Vor allem für die Zürcher S-Bahn will die Bahn über 120 neue Züge beschaffen. Es könnte der potenziell teuerste Auftrag werden, den die SBB je vergeben haben.
Zu einer offiziellen Ausschreibung kam es bisher noch nicht. Es wird erwartet, dass sowohl Stadler als auch Alstom und Siemens Interesse anmelden dürften. Siemens hat bereits 61 Züge der zweiten Generation der Zürcher S-Bahn geliefert, die seit dem Jahr 2006 im Einsatz sind. Siemens-Schweiz-Chef Gerd Scheller kritisierte vor gut einem Jahr gegenüber der NZZ , dass sich hierzulande so oft Stadler durchsetze. Wenn die SBB nur noch als Stadler-Bundesbahnen wahrgenommen würden, «wäre dies sehr schlecht für künftige Innovationen und Investitionen in die Schweizer Bahnindustrie». (ehs)
11:46 Uhr
Donnerstag, 4. April
Zürcher PKB-Bank muss Strafe zahlen
Die Bundesanwaltschaft hat die PKB Privatbank per Strafbefehl verurteilt. Das Zürcher Finanzinstitut muss eine Busse von 750’000 Franken bezahlen. Die Bundesanwaltschaft kam in ihrer Untersuchung zum Schluss, dass die Bank zwischen 2011 und 2014 nicht alle zumutbaren und erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen getroffen hat, um zu verhindern, dass zwei ihrer Mitarbeiter – ein für die Entwicklung der südamerikanischen Kundenbeziehungen zuständiger Kundenberater und sein direkter Linienvorgesetzter – die Straftat der schweren Geldwäscherei begehen konnten.
Konkret konnten die Ermittler Geldwäscherei-Handlungen im Gesamtwert von über 20 Millionen US-Dollar feststellen. «Die PKB hat die Identität des wirtschaftlich Berechtigten der Vermögenswerte, die auf bestimmten Bankverbindungen bei der Geschäftsstelle in Lugano hinterlegt waren, nicht korrekt überprüft. Ebenso hat sie es unterlassen, die Umstände und den Zweck der durchgeführten Transaktionen zu klären und sicherzustellen, dass es sich hierbei um nichts Aussergewöhnliches handle und/oder kein Verdacht bezüglich ihrer Herkunft bestehe», heisst es in einer Mitteilung.
Da die Bank keine Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben hat, ist er rechtskräftig. (mpa)
10:19 Uhr
Donnerstag, 4. April
Migros kooperiert mit Illy Caffè
Die Migros baut ihr Angebot an nachhaltigen CoffeeB-Bällen aus. Dazu spannt der Händler mit der italienischen Traditionsmarke Illy Caffè zusammen. Das Ergebnis seien zwei Espresso-Röstungen, die ausschliesslich aus Arabica-Bohnen hergestellt werden, heisst es in einer Medienmitteilung. Matthias Wunderlin, Leiter der Migros-Industrie, sagt dazu: «Durch die Partnerschaft mit illycaffè können wir das langjährige italienische Kaffee-Erbe und Know-how in unsere noch junge Marke integrieren und unser Angebot an feinsten Aromen erweitern.» Erst kürzlich wurde bekannt, dass der US-Kaffeeriese Keurig auf die Technologie von Coffee B setzt, die das Kompostieren der Kaffee-Bälle erlaubt. (mpa)
08:38 Uhr
Donnerstag, 4. April
Preise bleiben stabil
Der Landesindex der Konsumentenpreise misst die Teuerung eines durchschnittlichen Warenkorbs. Im März blieb der Index im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 107,1 Punkten. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat betrug die Teuerung 1 Prozent. Dies geht aus den Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor. Damit hat sich die Inflation deutlich abgeschwächt (siehe Grafik).
Die Preisstabilität gegenüber dem Vormonat resultiert aus entgegengesetzten Entwicklungen, die sich insgesamt aufgewogen haben. Die Preise für Pauschalreisen ins Ausland und den Luftverkehr sind gestiegen, ebenso wie jene für Bekleidung und Schuhe. Die Preise für die Parahotellerie und für Automobile sind hingegen gesunken, ebenso wie die Miete von privaten Verkehrsmitteln. (mpa)
08:01 Uhr
Donnerstag, 4. April
Signa-Pleitier Benko sagt Auftritt ab
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur mutmasslichen Bevorzugung von Superreichen in Österreich wird am Donnerstag ohne den Ex-Milliardär René Benko tagen. Wenige Wochen nach dem Zusammenbruch seines Immobilien-Imperiums sollte er vor dem Ausschuss in Wien als Zeuge aussagen. Benkos Anwalt sagte jedoch kurzfristig für seinen Mandanten ab. Der Jurist verwies dabei auf rechtliche Risiken wegen strafrechtlicher Verfahren gegen Benko, wie aus dem Brief des Anwalts an das Parlament hervorgeht. Es wäre der erste öffentliche Auftritt des einst als Immobilien-Tycoon gefeierten Unternehmers seit der Pleite-Serie der von ihm gegründeten Signa-Gruppe gewesen.
Das Gremium des Parlaments in Österreich wurde von der Opposition eingesetzt, um die mutmassliche Bevorzugung von Superreichen zu beleuchten, die Verbindungen zur konservativen Kanzlerpartei ÖVP pflegen.
Benko hat sich in den vergangenen Monaten kein einziges Mal öffentlich zu den zahlreichen Insolvenzen von Signa-Firmen wie Galeria Karstadt Kaufhof und KaDeWe geäussert. Der 46-Jährige hatte in Zeiten niedriger Zinsen ein undurchsichtiges Firmennetzwerk aufgebaut, zu dem unter anderem der unfertige Elbtower in Hamburg, die mittlerweile insolventen Kaufhausmarken KaDeWe und Galeria Karstadt Kaufhof sowie die Globus-Warenhauskette in der Schweiz gehören. Mit dem Anstieg von Zinsen, Baukosten und Energiepreisen ist die Signa-Gruppe weitgehend zusammengebrochen. (dpa)
07:39 Uhr
Donnerstag, 4. April
Milliardenstrafe für Rohstoffhändler
Das amerikanische Justizdepartement verkündete letzte Woche einen Sieg gegen Rohstoffhändler, die in Afrika und Lateinamerika Bestechungsgelder gezahlt hatten. So wollten die Firmen an staatliche Aufträge kommen. Nach jahrelangen Ermittlungen schliesst die US-Behörde die Fälle mit 20 Verurteilungen und Strafzahlungen von über 1,7 Milliarden Dollar ab. Betroffen sind mit Glencore, Vitol, Trafigura und Gunvor auch einflussreiche Händler mit Sitz oder Wurzeln in der Schweiz. Unter den Verurteilten befinden sich sechs Beamte, acht Zwischenhändler und fünf Rohstoffhändler. Zudem sei ein früherer Vitol-Trader wegen Geldwäsche verurteilt worden.
Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» begrüsste Oliver Classen, Sprecher der Nichtregierungsorganisation Public Eye, den harten Kurs der US-Behörden. Allerdings merkt er an: «Problematisch ist aber, dass die Erträge aus den Rohstoffen als Steuern in der Schweiz oder als Bussen in den USA landen, nicht aber dort, wo sie gefördert wurden und besonders gebraucht würden.» (mpa)
07:09 Uhr
Donnerstag, 4. April
Bio-Preis kommt nicht bei den Bauern an
Bio-Bauern erhalten nur wenig höhere Preise, aber die Konsumenten zahlen einen viel höheren Preis für Bioprodukte im Supermarkt. Das ist das Fazit des zweiten Preismonitors des Vereins Faire Märkte Schweiz. Erstellt hat es der Ökonom Mathias Binswanger. Demnach landen von einem Franken, den Konsumentinnen und Konsumenten für Bioprodukte ausgeben, 33 Prozent beim Bauern. Bei günstigen Varianten von Standardprodukten liegt dieser Anteil hingegen bei 41 Prozent.
«Die beiden Grossverteiler Migros und Coop dominieren den Schweizer Lebensmittelmarkt und besitzen erhebliche Marktmacht», schreibt Faire Märkte Schweiz dazu, Diese habe zu Folge, dass man sowohl bei konventionellen als auch bei Bioprodukten gegenüber den Bauern geringe Preise durchdrücken könne.
Erstmals hat der Monitor auch die Discounter Aldi und Lidl betrachtet. Hier liegt der Mittelwert der Preisdifferenzen zwischen dem Konsumenten- und Produzentenpreis, deutlich tiefer als bei Migros und Coop. Besonders ausgeprägt sei dies bei Rindsplätzli und Kartoffeln, wo Aldi oder Lidl Biovarianten um rund 25 Prozent billiger anbieten. (mpa)
13:23 Uhr
MITTWOCH, 3. APRIL
Swiss zählt über Ostern rund 200’000 Passagiere
Die Fluggesellschaft Swiss hat von Karfreitag bis Ostermontag rund 200’000 Passagiere ans Ziel gebracht, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das seien 4,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Anzahl Flüge stieg im Vergleich zur Osterperiode 2023 um 1,2 Prozent auf knapp 1600.
Bei der Pünktlichkeit schnitt die Swiss hingegen schlechter ab. 73 Prozent der Swiss-Flüge starteten an den Osterfeiertagen pünktlich, das heisst mit weniger als einer Viertelstunde Verzug, wie die Swiss schreibt. Die Pünktlichkeit liege damit 7,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Grund dafür war laut Swiss insbesondere das Wetter: Starke Westwinde hätten zu einer reduzierten Kapazität am Flughafen Zürich geführt und entsprechend Verspätungen verursacht.
Beliebteste Swiss-Flugreiseziele in Europa waren laut Mitteilung London, Berlin und Palma de Mallorca, ausserhalb Europas waren es die US-Städte New York, Miami und San Francisco.
08:50 Uhr
Mittwoch, 3. April
Quickline mit tieferem Umsatz
Das Berner Telekommunikations-Unternehmen Quickline hat 2023 einen Umsatz von 245 Millionen Franken geschrieben. Das sind 2 Millionen oder 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Zurück ging die Zahl der Kundinnen und Kunden im Festnetz (-4,8 Prozent) und im margenträchtigen TV-Geschäft (-0,9 Prozent). Zulegen konnte Quickline hingegen bei den Mobilfunk-Kunden, deren Zahl auf 99'100 und damit um fast 17 Prozent stieg. Auch beim TV-Streaming-Angebot sowie bei den Internet-Anschlüssen legten Quickline und seine Partnerfirmen um 7,7 respektive 2,0 Prozent zu.
Seit September 2022 bietet Quickline seine Produkte nicht nur im eigenen Kabelnetz und in den Netzen der Partner an, sondern in der ganzen Schweiz. Dafür greift das Unternehmen auf die Infrastruktur der Swisscom zurück – etwa deren Glasfaser- und Kupfer-Netz sowie das Mobilfunknetz.
Vor kurzem verliess der frühere CEO Frédéric Goetschmann das Unternehmen wegen Differenzen bei der Expansion, wie das Portal Inside-IT berichtete . Es seien Meinungsverschiedenheiten zur Geschwindigkeit und Art der Expansion aufgetreten. Seit Januar führt Verwaltungsratspräsident Felix Kunz die Firma ad interim. Tatsächlich kann die Expansion bisher nicht als grosser Erfolg gewertet werden: Quickline konnte in keinem Bereich zu den grossen Anbietern Swisscom, Sunrise und Salt aufschliessen, der Kundenzuwachs ist trotz Marketing-Aktionen wie dem Verschenken von Handy-Abos bescheiden. Gleichzeitig dürfte der Vertrag mit der Swisscom Kosten mit sich bringen, die durch neue Kundinnen und Kunden refinanziert werden müssen. (ehs)
07:04 Uhr
MITTWOCH, 3. APRIL
Swiss Re erhält einen neuen CEO
Chefwechsel beim Schweizer Rückversicherer Swiss Re: Der langjährige CEO Christian Mumenthaler gibt seinen Posten ab, Nachfolger wird Andreas Berger, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Wechsel erfolgt per 1. Juli 2024. «Mit dem Rückenwind der Erreichung aller finanziellen Ziele für 2023, einer Dividendenerhöhung und den positiven Auswirkungen der Umstrukturierung der Gruppe ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den CEO-Wechsel», wird Jacques de Vaucleroy, Vizepräsident des Verwaltungsrats, in der Medienmitteilung zitiert.
Der 54-jährige Mumenthaler arbeitet seit 1999 für Swiss Re, 2016 wurde er zum CEO ernannt. Sein Nachfolger Andreas Berger (57) arbeitet seit März 2019 bei Swiss Re und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor hatte er unter anderem bei der Boston Consulting Group, bei Gerling und Allianz gearbeitet. Er wurde in Rwanda geboren, hat die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in der Nähe von Zürich. (mjb)
06:18 Uhr
Mittwoch, 3. April
Freundlich, aber zu teuer: Schweizer sind mit Krankenkassen zufrieden – aber nicht mit Prämienhöhe
Die Versicherten in der Schweiz sind mit ihren Krankenkassen im allgemeinen zufrieden. Am positivsten wurde die Freundlichkeit der Mitarbeitenden beurteilt, am negativsten das Preis-Leistungsverhältnis. Das ergab eine Umfrage des Onlineportals Moneyland mit 1500 Befragten.
Beim Kriterium «allgemeinen Zufriedenheit» vergaben die Befragten im Schnitt 7,8 von 10 möglichen Punkten. Je nach Alter, Region und Kriterium gebe es aber grössere Unterschiede, schreibt Moneyland. Jüngere sowie Westschweizer Versicherte seien im Schnitt unzufriedener mit ihrer Krankenkasse. Auch zwischen den Krankenkassen gibt es Unterschiede: Am besten abgeschnitten haben bei der Umfrage Sanitas, Swica, ÖKK und KPT, am Ende der Rangliste rangiert wie im Vorjahr die Assura. (mjb)
15:51 Uhr
Dienstag, 2. April
Es wurde im Februar weniger eingekauft
Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze sind im Februar 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal um 0,4 Prozent gefallen. Dies zeigen die gestern publizierten, provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS). Auch die realen, ebenfalls um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze sind im Februar 2024 im Vorjahresvergleich gesunken – und zwar um 0,2 Prozent. Auch gegenüber dem Vormonat sind die Detailhandelsumsätze nominal und real um 0,2 Prozent respektive 0,1 Prozent zurückgegangen. (fv)
15:21 Uhr
Dienstag, 2. April
Gutes Börsenklima - auch dank Galderma
In Europa und Amerika waren die Bedingungen für Börsengänge im ersten Quartal 2024 deutlich positiver als vor einem Jahr: In den USA gab es von Januar bis März insgesamt 49 Börsengänge, im Vorjahresquartal waren es «nur» 33. Das Gesamtvolumen sprang von 2,6 Milliarden auf 8,5 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2024. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung des Beratungsunternehmens EY. In Europa lag die Zahl der Börsengänge gemäss dem neusten IPO-Barometer mit 26 leicht unter dem Vorjahresquartal, als noch 28 Firmen den Sprung aufs Parkett wagten. Beim Volumen hingegen gab es in Europa mit umgerechnet 5,9 Milliarden US-Dollar fast eine Verdreifachung.
Der allergrösste Börsengang des Jahres kam aus der Schweiz. Die Kotierung der Galderma-Gruppe, einer Hautspezialistin mit Sitz in Zug, an der Schweizer Börse Six erbrachte knapp 2,3 Milliarden Schweizer Franken. Das entspricht gemäss EY «fast genau dem gesamten Volumen aller zehn Börsengänge in der Schweiz des letzten Jahres». Und es ist demnach der grösste Börsengang an der Six seit Landis & Gyr in 2014. (fv)
07:38 Uhr
Dienstag, 2. April
Wienand neuer Chef der Lonza – Baehny zieht sich zurück
Wolfgang Wienand wird neuer CEO der Lonza. Das hat das Unternehmen am Dienstagmorgen mitgeteilt. Wienand ist derzeit CEO der Siegfried Holding AG, eine Funktion, die er seit 2019 innehat. Davor war er im gleichen Unternehmen als Chief Scientific Officer und dann als Chief Strategy Officer tätig. Wienand wird bei Lonza auf Albert Baehny folgen, der das Unternehmen seit Oktober 2023 als Verwaltungsratspräsident und CEO im Doppelmandat führt. Baehny wird das Unternehmen im Sommer verlassen. Zu seinem Nachfolger sagt Baehny in der Medienmitteilung: «Wolfgang bringt eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen in die Lonza ein, die durch seine profunde wissenschaftliche und strategische Expertise ergänzt werden.» Wienand blickt als Florettfechter auf eine erfolgreiche sportliche Karriere zurück. Er nahm für Deutschland an den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta und 2000 in Sidney teil. ( sbü .)